Triggerwarnung
Der Artikel befasst sich mit der bipolaren Störung. Bestimmte Inhalte oder Wörter können negative Gefühle oder Erinnerungen auslösen. Wir möchten dich darauf hinweisen, den Artikel nicht zu lesen, falls du dich heute nicht stabil genug fühlst.
Die Achterbahn: Selma
Selma* hat schon früh viel Verantwortung übernommen, denn ihre Mutter ist bipolar. Eine Erzählung.
Text: Name der Autorin redaktionell anonymisiert
Illustration: Jana Reininger
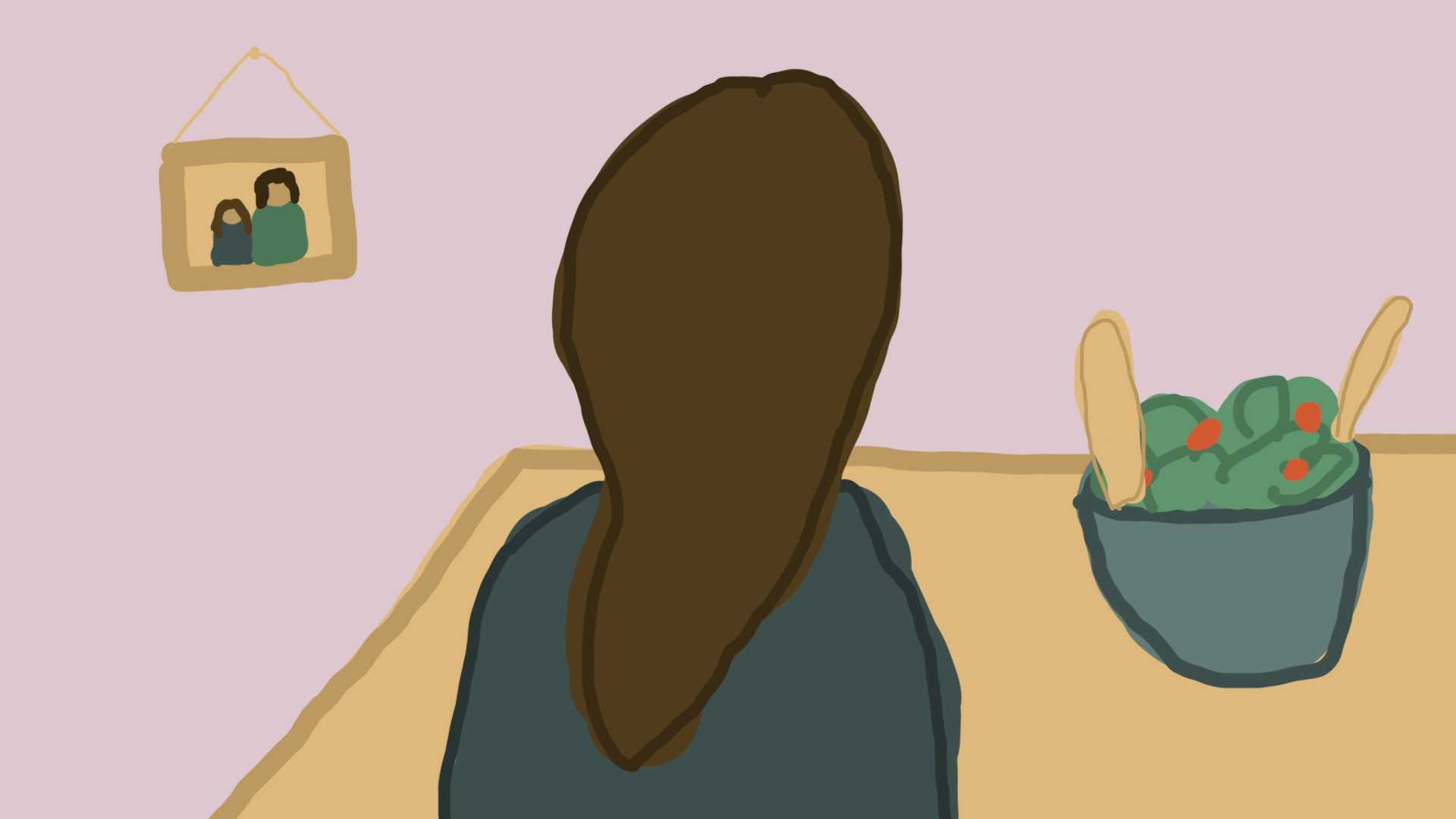
Es ist ein warmer Maitag im Jahr 2012 und eigentlich läuft gerade alles wie am Schnürchen. Die letzte Matheschularbeit war wieder mal eine Eins, am Wochenende feiern wir den 16. Geburtstag meiner besten Freundin und die Sommerferien stehen bald vor der Türe. Ich freue mich. Summend radle ich durch die ruhigen Gassen meiner Kleinstadt in Richtung Mittagessen. Wenn ich Gas gebe, geht sich vor dem Geigenunterricht sogar noch ein kurzer Powernap aus. Als ich aber schließlich vor meinen Spaghetti Bolognese sitze, beschleicht mich ein ungutes Gefühl. Mit einer bipolar erkrankten Mutter aufzuwachsen, verpasst einem ziemlich feine Stimmungsantennen. Am besten funktionieren sie für die eigene Familie. Es gibt immer diesen einen Moment, an dem einem auf einmal auffällt, dass sich gerade irgendwas verändert – und meine „Alarmantennen“ schlugen in diesem Moment an. Gestern war noch alles normal und heute ist irgendetwas anders. Meistens ist es der Blick meiner Mutter. Anderen würde das zu dem Zeitpunkt vermutlich noch nicht auffallen. Er ist nicht großartig anders, aber doch.
So sitze ich also vor meinen Spaghetti und das Gefühl der Ohnmacht überrollt mich wieder einmal wie ein Lastwagen. „Nicht schon wieder, nicht jetzt“. Wovon ich spreche ist eine sich anbahnende Manie. Das ist am Anfang nur ein komischer Blick. Am nächsten Tag schon andere Gesprächsinhalte, etwa über Zeichen, die sie sieht, die ihr sagen, erleuchtet zu sein. Und spätestens nach ein paar Tagen mangelnder Schlaf. Das bedeutet: Wochen und Monate, in denen neben der Welt meiner Mutter auch meine eigene Kopf steht. Keine Krankheitseinsicht, tausende Überredungsversuche in die Klinik zu gehen, laute Musik in der Nacht, tanzen mitten im Supermarkt – eine Mama zu haben, die nicht mehr deine Mama ist. Am Ende meist Polizei, Handschellen und Unterbringung ins Krankenhaus. Die Person, die die Polizei ruft, bin meist ich, da ich allein mit meiner Mutter wohne. Die eigene Mutter zu ihrem Schutz, aber dennoch gegen ihren Willen in der geschlossenen Psychiatrie. Daraufhin folgen zahlreiche Besuche, eine Mutter, die erst noch tobt und wütend auf dich ist und irgendwann weinend und zusammengerollt im Krankenhausbett liegt und von dir getröstet werden will. Irgendwann stabilisiert sich die Situation und Mama kommt wieder heim. Während am Anfang noch einige von Depression geprägte Wochen kommen, fühlt sich der Alltag irgendwann fast wieder ein bisschen normal an. Man holt Luft, atmet durch und genießt die Normalität. Bis eines Tages wieder der Moment kommt, an dem man ins Gesicht der eigenen Mutter schaut und sich denkt „Nicht schon wieder, nicht jetzt“.
Zehn Jahre später sitze ich hier und vieles ist anders. Ich bin erwachsen, zumindest auf dem Papier. Meine Heimatstadt und mich trennen jetzt viele hunderte Kilometer. Vor sechs Jahren saß ich mit gepackten Kisten im Umzugswagen und dachte mir: „Ich hoffe meine Mutter überlebt das“. Momente der Verzweiflung, zu lernen, in Krisen nicht vor Ort zu sein, Verantwortung abzugeben. Vieles ist anders, aber vieles ist auch noch gleich. Die Wellen der Manien und Depressionen meiner Mutterkommen und gehen nach wie vor. Eine chronische Erkrankung bleibt eben. Die gute Nachricht ist: Vieles ist trotzdem leichter geworden. Mit Abstand, Alter und Therapie kam die Reflexion. Welche Rolle will ich hier einnehmen? Wie arbeite ich all die unsichtbaren Narben auf? Was sind meine Aufgaben? Was ist meine Verantwortung?

„So sitze ich also vor meinen Spaghetti und das Gefühl der Ohnmacht überrollt mich wie ein Lastwagen.“
Ich bin früh und ziemlich schleichend in Rollen geschlüpft, die mir erst im Nachhinein bewusst wurden. Über meine ganze Kindheit und Jugend hinweg wurden gewisse Umstände für mich normal. „Natürlich passe ich auf meine Mama auf, wenn sie gerade nicht sie selbst ist. Wer soll das denn sonst machen? Natürlich stehe ich das jetzt wieder einmal durch. Hab ich denn eine Wahl?“. Heute weiß ich rational, dass ich eigentlich nicht für die Situation verantwortlich bin. Meine Mutter ist eine erwachsene Frau. Ich bin ihre Tochter und sie meine Mutter, nicht umgekehrt. Wenn du selber ständig an deine Grenzen gehst, kannst du irgendwann auch nicht mehr für andere da sein. Vor drei Jahren, nach einem Klinikaufenthalt meiner Mutter, hab ich aus dem Nichts Panikattacken bekommen, daraufhin begleitende Angstzustände. Ein Zeichen meiner Psyche, halblang zu machen. Und was mich erst zur Verzweiflung gebracht hat, weiß ich heute sogar fast ein bisschen zu schätzen.
Ich war immer jemand, der seine Probleme ganz gut bewältigen konnte, von Haus aus eine Frohnatur. Während in meiner Jugend Zuhause der Wahnsinn tobte, ging ich trotzdem viel raus, sah Freunde, hab mich anderen gegenüber geöffnet und mich immer an die Hoffnung geklammert, dass es doch immer wieder gut geworden ist. Das ist natürlich schön, lässt einen selber aber auch schwer bemerken, was man da eigentlich auf sich nimmt. Woher weiß man, wo die eigenen Grenzen liegen, wenn diese schon seit der Kindheit verschoben sind? Die Panikattacken vor drei Jahren waren ein klares Zeichen: Dir geht es nicht gut, du musst da hinschauen. Wäre mir das damals nicht passiert, könnte ich das mit dem Zurücknehmen heute wahrscheinlich noch schlechter.
Das klingt jetzt wahrscheinlich, als wäre alles relativ gut verlaufen. Ich bin ausgezogen, habe gelernt auf meine Psyche zu schauen und weiß, ich muss mich zurücknehmen. Ich sitze aber auch gerade hier und meine Mutter ist stabil. Kaum klopft die nächste Krise an, ist da trotzdem diese unendlich große Liebe der eigenen Mutter gegenüber. Alles in einem schreit: „Du bist meine Mutter. Du hast mich großgezogen. Du hast alles in deiner Macht Stehende für mich getan. Natürlich stehe ich neben dir bis zum bitteren Ende.“ Dann nicht sofort in den nächsten Zug zu springen und alles liegen und stehen zu lassen ist schwer. Ein ständiger innerer Balanceakt. Schönreden kann ich dabei nichts. Das wird immer schwer bleiben und das wird auch, so lange meine Mutter lebt, ein Prozess bleiben. Ich weiß nicht, wie ich diesen Prozess bewältigen könnte, wenn ich mich nicht anderen gegenüber geöffnet hätte. Selbsthilfegruppe, Therapie und Ehrlichkeit meinem Umfeld gegenüber sind mitunter meine größten Ressourcen. Ich hoffe, dass sich in diese Richtung noch vieles tut. Dass die Menschen realisieren, dass Geschichten wie meine hunderttausende Kinder in Österreich betreffen. Dass wir als Gesellschaft lernen, offener mit psychischen Erkrankungen umzugehen. Damit man sich nicht zusätzlich zu all den Belastungen schon von klein auf wahnsinnig alleingelassen fühlt.
*Name von der Redaktion anonymisiert
Dieser Beitrag entstand in Kooperation mit dem Projekt #visible – Kinder psychisch erkrankter Eltern sichtbar machen. Du vermutest oder weißt, dass deine Mama oder dein Papa psychische Probleme hat? Bei #visible kannst du dich online beraten lassen.