Triggerwarnung
Der Artikel thematisiert suizidale Gedanken. Bestimmte Inhalte oder Wörter können negative Gefühle oder Erinnerungen auslösen. Wir möchten dich darauf hinweisen, den Artikel nicht zu lesen, falls du dich heute nicht stabil genug fühlst.
Die Unsichtbaren
Wer an Long Covid erkrankt, muss hart um Anerkennung kämpfen. Das verunmöglicht die Chancen auf Besserung und begünstigt Armut.
Text: Karina Grünauer und Jana Reininger da Rosa
Bildelemente: Egon Scherl, ÖG ME/CFS, Michaela Pranter Photography, feelimage / MedUni Wien sowie generiert mit Hilfe von ChatGPT und DALL·E, OpenAI (2025) Collagen: Jana Reininger da Rosa / ZIMT Magazin

Die Liste der Dinge, die Sandra braucht, wenn sie das Haus verlassen möchte, ist lang: die Stützstrümpfe, um den Kreislauf in Schach zu halten, der Rollstuhl, um sich fortbewegen zu können, die Sonnenbrille, um das Licht abzudämpfen, die Gesichtsmaske, um Gerüche abzuwenden – und gerade erst hat sich die 35-Jährige neue Kopfhörer gekauft, nämlich solche, die die Geräusche ihrer Umwelt unterdrücken. „Gerüche, Geräusche und Licht können schnell zu viel werden und Panik auslösen, wenn ich die entsprechenden Reize nicht schnell genug minimiere”, erklärt die Wahlwienerin.
Es sind Symptome von Long Covid, mit denen viele wohl nicht rechnen – und für Sandra nur ein Bruchteil der Risiken, mit denen sie sich seit drei Jahren auseinandersetzen muss. Damit ist Sandra nicht alleine. Rund zehn Prozent der Menschen, die sich in den letzten Jahren mit Corona infiziert haben, sind von Long Covid betroffen: ca. 80.000 Menschen, so offizielle Schätzungen. Inoffiziell wird von einer umso höheren Dunkelziffer gesprochen.
Wer sich mit den Folgen der Viren auseinandersetzt, stößt schnell auf umso mehr Fragezeichen, denn: Es fehlt an Forschung und an Behandlungsmöglichkeiten, an kompetenten Mediziner:innen und an Anlaufstellen, die Betroffene ernst nehmen. Vor allem Frauen mit Long Covid werden ihre Erkrankungen oft gar nicht geglaubt – das Medical Gaslighting belastet folglich ihre psychische Gesundheit und lässt sie in eine Armutsspirale hinein rutschen.

Die Liste der Dinge, die Sandra braucht, um das Haus zu verlassen, ist lang.
Sandra ist Anfang 30, als sie als Fachtrainerin in der Erwachsenenbildung arbeitet – ein gut bezahlter Job in der IT, der ihr Spaß macht, wie sie erzählt. In ihrer Freizeit spielt sie in einem international erfolgreichen Flag Football-Team, einer kontaktlosen Variante des American Football, Sie wurde Europameisterin und Vizeweltmeisterin. „Ich bin eigentlich ein wirklich aktiver, sozialer Mensch, auch sehr quirlig”, erzählt die gebürtige Niederösterreicherin. Doch dann ändert sich alles.
Zweimal infiziert sie sich mit Corona – trotz vorzeitiger Impfung, weil Sandra mit ihren Vorerkrankungen als Risikopatientin gilt, trotz Social Distancing, an das sie sich damals streng hält, wie sie fünf Jahre später im Gespräch mit ZIMT erzählt. „Einen Elefanten auf der Brust”, so nennt Sandra das Gefühl des Lungendrucks, das nur der Anfang einer langen Krankheitsreise werden soll.
Plötzlich wird es still
„Während der ersten Infektion habe ich schon gemerkt, dass in meinem Körper und besonders in meinem Hirn etwas passiert, das ich von keiner anderen Erkrankung gekannt habe.” Wegen ihrer Schmerzen in den Muskeln, in den Gelenken, in den Knochen und wegen der anhaltenden Schwäche muss Sandra das Flag Football nach zehn Jahren aufgeben. Tagsüber fühlt sie sich erschöpft, abends kann sie nicht einschlafen. Immer wieder wacht sie nachts auf, aller Müdigkeit zum Trotz. Die Konzentration fällt schwer, ihr Denken wird langsam. Reize wie Licht, Geräusche oder Gerüche überfluten sie, lösen Panik aus, wenn sie sich nicht rasch zurückziehen kann.

Vor ihrer Erkrankung war Sandra Europameisterin und Vizeweltmeisterin im Flag Football.
Nach drei Wochen Krankenstand schleppt sie sich wieder zur Arbeit, versucht ihren Alltag genauso zu leben wie zuvor, bis sie sich ein halbes Jahr später erneut mit Covid-19 ansteckt. Mit ihrer Gesundheit geht es anschließend rasant bergab. Anfangs bessern sich manche Beschwerden für kurze Zeit. Doch sie verschwinden nie ganz, im Gegenteil: Jedes Mal, wenn Sandra sich überanstrengt, kommen mehr neue Symptome hinzu. Es ist ein Kreislauf, der sich wiederholt – und dabei jedes Mal schlimmer wird. „Ich habe irgendwann erkannt: Es ist immer derselbe Zyklus. Und er verschärft sich mit jedem Crash.“ Heute, drei Jahre nach der Erstinfektion, ist die 35-Jährige auf einen Rollstuhl angewiesen.
Die Folgen einer Corona-Infektion können vielseitig ausfallen: Herzinfarkte, Schlaganfälle und Autoimmunerkrankungen sind nur ein Teil der erhöhten Risiken. Bereits bestehende Erkrankungen wie beispielsweise der Lunge oder des Herzens, aber auch psychiatrische Krankheiten können sich durch die Viruserkrankung verschlechtern, erklärt Kathryn Hoffmann, die, als eine der beiden Leiterinnen im Referenzzentrum für postvirale Syndrome in Wien, Wissen rund um die Virusfolgen sammelt und sich um internationale Vernetzung von Informationen und weiterführende Forschung kümmert. Grundsätzlich gilt: Alle Schäden, die durch Covid-19 ausgelöst wurden und länger als vier Wochen anhalten, werden als Long Covid bezeichnet.
Besonders schwerwiegend ist es, so die Forscherin, wenn dabei ein postakutes Infektionssyndrom, etwa die Fehlfunktion des autonomen Nervensystems, oder ME/CFS, kurz für Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue Syndrom, ausgelöst wird. ME/CFS ist eine chronische Multisystemerkrankung, bei der Betroffene neben Schmerzen, Schlafstörungen und neurokognitiven Beeinträchtigungen vor allem eine extreme Aktivitäts-Erholungsstörung auf Zellebene (postexertionelle Malaise, PEM) erleben. So auch Sandra.
„Es fühlt sich an, als hätte ich 40 IQ-Punkte verloren”, erzählt Sandra im Gespräch mit ZIMT. Plötzlich versteht sie Texte nicht mehr, kann Gesprächen mit Freund:innen und Bekannten nicht mehr folgen. Wenn Sandra aufsteht, kämpft ihr Körper spürbar gegen die Schwerkraft an. Er schafft es nicht, genügend Blut durch die Arterien zu pumpen, ihr Herz beginnt zu rasen und Sandra wird schwindelig. „Wenn ich zu lang stehe, dann knicken mir die Beine weg und ich beginne zu krampfen oder werde überhaupt ohnmächtig.” Mit gewöhnlicher Müdigkeit – das ist Betroffenen immer wieder wichtig zu betonen – ist ME/CFS nicht zu vergleichen.

Drei Jahre nach der Erstinfektion ist Sandra auf einen Rollstuhl angewiesen.
Schmerzen in den Muskeln, in den Gelenken, in den Knochen oder im Kopf, Regulationsstörungen der Körpertemperatur und des Herzkreislaufs, Haut- und Magen-Darm-Probleme, “you name it”, sagt Sandra. „Es gibt keine Situation, in der sich die Krankheit nicht zeigt.” Wenn die ehemalige Leistungssportlerin über ihre Erkrankung spricht, wirkt das Gesagte routiniert. Man merkt, dass sie ihre Krankheit immer wieder erklären muss, weil andere Menschen sie einfach nicht kennen. „Wäre mein Leben ein Online-Game, dann wäre es so, als hätte mir jemand einfach den Controller aus der Hand geschlagen und mitgenommen. Und ich stecke fest, kann mich nicht rühren und muss zusehen, wie es für alle anderen weitergeht.”
Long Covid ist neu, ME/CFS gibt es schon lange
ME/CFS ist keine neue Erkrankung. Die ersten Aufzeichnungen des Begriffs der myalgischen Enzyphalomyelitis, also ME, lassen sich bereits im Jahr 1955 finden, als es zu einem Infektionsausbruch im Royal Free Hospital in London kam, und selbst das dürften noch nicht die ersten bekannten Krankheitsfälle gewesen sein. Schon die 1910 verstorbene Florence Nightingale, eine britische Krankenschwester, die heute als Begründerin der modernen westlichen Krankenpflege gilt, dürfte an ME/CFS erkrankt gewesen sein.
Was jedoch neu ist: Heute häuft sich die Erkrankung. Mehr als die Hälfte der Long Covid-Erkrankten sind von ME/CFS betroffen, so heißt es auf der Website der Deutschen Gesellschaft für ME/CFS – und ein Großteil der Betroffenen, so wissen wir es aus internationalen Studien, sind Frauen. Vor der Pandemie sollen in Österreich Schätzungen zufolge 30.000 bis 80.000 Menschen betroffen gewesen sein. Das ist eine große Spannbreite, denn konkrete Zahlen gibt es nicht, wie Astrid Hainzl von der Österreichischen Gesellschaft für ME/CFS erklärt – und das führt auch schon zum Kern des Problems. „Das ist, was uns ratlos zurücklässt: Es gibt keine Erhebungen und keine Daten und es werden auch keine Erhebungen in Auftrag gegeben. Aber ohne Erhebung vom Bedarf, gibt es keine Planung von Versorgung.”
„Massiv unterfinanziert”, nennt Kathrin Hoffmann die Studienlage rund um Long Covid. Zugelassene Medikamente oder andere Therapien gibt es bisher nicht, nur Möglichkeiten bestehende Symptome zu reduzieren.
Kann denn niemand helfen?
Zwei Jahre lang sucht Sandra nach ihrer ersten Infektion verzweifelt bei unterschiedlichen Ärzt:innen nach Hilfe. „Es hat mir einfach niemand sagen können, was konkret mit mir los ist oder an wen ich mich wenden kann.” Ihre Erkrankung sei etwas Neues, heißt es in den Ordinationen oft, es gebe noch keine Literatur dazu. „Jetzt weiß ich, dass sie nicht neu ist und auch vor drei Jahren nicht war, und ich zu der Zeit schon am besten Weg in die Chronifizierung war, da meine Symptome nicht ernst genommen wurden und ich keine Behandlung erhalten habe.”

Zwei Jahre lang sucht Sandra nach ihrer ersten Infektion verzweifelt bei unterschiedlichen Ärzt:innen nach Hilfe.
Zweimal wird Sandra zur Reha geschickt – beide Aufenthalte führen nicht zur erhofften Stabilisierung, sondern zu einer Verschlechterung. Die erste Klinik ist eine psychiatrische. Sandra ist irritiert. Sie hat Long Covid, keine psychiatrische Diagnose. Auf ihren Hinweis reagiert ein Mitarbeiter ihres Versicherungsträgers mit den Worten: „Das ist eh dasselbe“ – eine Aussage, von der Sandra weiß, dass sie falsch ist.
Die Einrichtung wirbt auf ihrer Website mit Spezialisierung auf Long Covid – ein leeres Versprechen, wie sich herausstellt. Kaum jemand im Team versteht, was mit Sandra passiert. Nach drei Wochen steht sie kurz vor dem Abbruch: „Es ging mir deutlich schlechter als bei der Ankunft.“ Die ärztliche Leitung ist in den ersten Wochen auf Urlaub, das Programm überfordert Sandra, die Beschwerden nehmen zu. Muskelzittern und Haarausfall setzen ein. Nur einzelne Elemente – etwa die Ergotherapie – helfen kurzzeitig.
Auch in der zweiten Reha, diesmal für den Bewegungs- und Atmungsapparat, bleibt Besserung aus. Stattdessen verschlimmert sich das posturale orthostatische Tachykardiesyndrom, kurz POTS: Ihr Kreislauf reagiert nun bereits auf kleinste Belastungen. Die behandelnde Ärztin spricht Sandra die Motivation ab, die Reha durchzuziehen. „Wenn Sie das nicht schaffen, fahren Sie besser heim“, urteilt sie. Sandra bleibt dennoch bis zum Ende. Im Entlassungsbericht wird dokumentiert: die Motivation sei „infrage zu stellen“.
Die Symptome häufen sich, die Verzweiflung auch. Die einstige Sportlerin weiß nicht mehr, wohin, welche Fachrichtung zuständig ist, wer überhaupt helfen könnte. Erst eine Allgemeinmedizinerin, auf die sie zufällig stößt, überweist sie zur Neurologie – mit Verdacht auf ME/CFS. Die Diagnose selbst dauert. Als sie sie endlich erhält, ist aus dem Verdacht längst ein klares Bild geworden: Sandra hat jegliche Symptome, die mit ME/CFS in Zusammenhang stehen.
Rückblickend glaubt die 35-Jährige: Hätte sie damals finanzielle Unterstützung durch Reha-Geld bekommen, hätte sich ihre Situation womöglich nicht so drastisch verschlechtert. „Ich hätte mir unzählige Crashes erspart – und vielleicht wieder ein halbwegs normales Leben führen können. Aber stattdessen hat jede Reha, jede Begutachtung meinen Zustand weiter zementiert.“
Warum glaubt uns denn niemand?
Nimmt medizinisches Personal die Beschwerden einer Person nicht ernst – oder redet ihr gar ein, dass diese sich ihre Symbole nur einbilde, hat das einen Namen: Medical Gaslighting. Diese Praxis kann auf Betroffene maßgebliche Folgen haben, so berichten es etwa die US-Neurologin Anna Hayburn und Medizinethikerin Devora Shapiro in einem Fachartikel im Jahr 2024. Sie können beginnen, an ihrer eigenen Wahrnehmung zu zweifeln, ihr Selbstvertrauen und somit letztlich auch Selbstwertgefühl abbauen. Die wiederholte Erfahrung, nicht ernst genommen zu werden, kann zu Angstzuständen und Depressionen führen. In schweren Fällen können sogar Traumata entstehen, was wiederum die Entstehung einer posttraumatischen Belastungsstörung und damit Ängste, Schlafstörungen und Flashbacks begünstigt.
Long Covid kann auf die Psyche schlagen, hat aber ursächlich nichts mit psychischer Gesundheit zu tun. „Long Covid ist keine psychische Erkrankung“, stellt Prim. Dr. Georg Psota, Chefarzt der Psychosozialen Dienste in Wien, klar. „Aus psychiatrischer Sicht ist es wichtig, die durch Post Covid oder ME/CFS ausgelösten Erschöpfungszustände nicht mit klassischen psychischen Krankheitsbildern wie Depressionen zu vermengen. Diese postviralen Syndrome folgen einem anderen Muster – sie sind körperlich-medizinisch begründet, auch wenn sie natürlich psychisch belasten können. Aber sie sind nicht in erster Linie Ausdruck einer psychischen Erkrankung.“ Das ist auch allen anderen wichtig zu betonen: Der Medizinerin Kathryn Hoffmann genauso wie Astrid Hainzl, Alexa Stephanou wie auch Sandra. Diesem Irrtum begegnen sie alle nämlich immer wieder – mit fatalen Folgen.

Alexa Stephanou, Astrid Hainzl und Kathryn Hoffmann (v.l.n.r.) setzen sich mit ME/CFS auseinander.
Je öfter Ärzt:innen und Gutachter:innen ihre Erfahrungen absprechen, desto mehr beginnt auch Sandra schließlich an ihrer Wahrnehmung zu zweifeln. Sie fühlt sich wütend und deprimiert. In einer Schweizer Studie untersuchten Forscher:innen im Jahr 2021 169 Personen, die an ME/CFS erkrankt sind. Zwei Drittel der Studienteilnehmer:innen fühlten sich stigmatisiert, nahezu 90 Prozent von ihnen gaben negative Folgen auf ihre psychische Gesundheit an: Traurigkeit, Hoffnungslosigkeit, Depressionen bis hin zu suizidalen Gedanken belasteten die Befragten. Auch Sandra beginnt zu resignieren. „Ich wollte einfach aufhören zu existieren.” Der Gedanke, so weiterleben zu müssen – in einem Zustand zwischen Schmerz, Isolation und systematischer Entwertung – war für sie kaum auszuhalten.
Alexa Stephanou ist Mitgründerin von Long Covid Austria, einem ehrenamtlichen Betroffenenverein, der Informationen zur Erkrankung, Behandlungsmöglichkeiten sowie Anlaufstellen sammelt, Betroffene miteinander vernetzt und sich um politische Anerkennung bemüht. Sie kennt das hohe Maß an Unsicherheit, das mit der Erkrankung einhergeht, gut – ein Damoklesschwert nennt sie die ME/CFS-Diagnose. Wer sie bekommt, weiß weder, wie die Krankheit weiter verlaufen wird, noch wie die richtige Behandlung aussehen kann. Die Wissenslücken rund um ME/CFS lassen sogar die Frage danach unbeantwortet, ob die Krankheit überhaupt heilbar ist.
Sandras Odyssee zur richtigen Diagnose kennen also viele, weiß auch Astrid Hainzl, die selbst acht Jahre lang auf ihre Diagnose warten musste. Die Versorgungslandschaft ist rar. Spezialisierte Ambulanzen für ME/CFS gibt es in Österreich nicht. „Das, was es gibt, ist eine Handvoll privater Ärzt:innen, die sich zumindest teilweise mit dem Thema beschäftigen. Das ist aber für ganz Österreich wirklich nur eine Handvoll.” Einen Termin bei diesen Mediziner:innen zu bekommen, ist schwierig – falls man sich deren Honorare überhaupt leisten kann. Dabei glaubt etwa Stephanou fest daran: Wer an richtig gute, und damit leider oftmals privat zu zahlende Ärzt:innen gelangt, kann durchaus Chancen auf Heilung haben.
Viele Ärzt:innen kennen ME/CFS nicht – einfach deshalb, weil die Erkrankung kein Bestandteil ihrer Ausbildung ist, erklärt Astrid Hainzl. Und was nicht bekannt ist, wird häufig falsch eingeordnet: „Wenn bei Standarduntersuchungen keine organischen Ursachen gefunden werden, gehen viele automatisch von einer psychischen Erkrankung aus“, sagt sie.
Schon Florence Nightingale, deren Symptome lange Zeit nicht als ME/CFS verstanden wurden, wurde nach ihrem Ableben im 20. Jahrhundert oft als bipolar interpretiert. Medical Gaslighting, so beschreiben es die Bioethikerinnen Diane E. Hoffmann und Anita J. Tarzian in einer US-Studie im Jahr 2020, betrifft meist Frauen. Auch Long Covid und ME/CFS betrifft überdurchschnittlich häufig Frauen.

Ihre Freund:innen schieben Sandras Rollstuhl, wenn sie das Haus verlässt.
Als Frau kenne sie es gut, bei Schmerzen nicht ernst genommen oder adäquat behandelt zu werden, sagt Sandra. Das ist keine rein subjektive Einschätzung. Der Gender Health Gap, also die unterschiedliche medizinische Versorgung zwischen den Geschlechtern, existiert tatsächlich, so belegt es etwa ein Bericht des Weltwirtschaftsforums im Jahr 2024: Frauen verbringen um 25 Prozent mehr Lebensjahre in schlechter Gesundheit als Männer. „Was aber Menschen, die an ME/CFS erkrankt sind, im österreichischen Gesundheitssystem widerfährt, ist noch mal ein ganz anderes Level an Menschenfeindlichkeit”, so Sandra, denn mit der richtigen Diagnose fängt ihr Kampf um die Existenzsicherung erst an.
In die Armut gerutscht
So wie ME/CFS für viele Mediziner:innen nicht zu existieren scheint, fehlt die Anerkennung der Erkrankung auch im sozialen Bereich, erklärt Astrid Hainzl. In der österreichischen Gesetzeslage ist sie einfach kein Thema. Deshalb wird auch Sandras Antrag auf Rehabilitationsgeld – also auf jene Sozialleistung, die krankheitsbedingt arbeitsunfähige Menschen finanziell unterstützen soll – abgelehnt. Zu jenem Zeitpunkt hilft ihr Lebensgefährte ihr jeden Tag in die Stützstrümpfe hinein, ohne die der 35-Jährigen sofort schwindelig würde. „Wer schon mal versucht hat, Stützstrümpfe anzuziehen, weiß, was für ein Kraftakt das ist”, sagt Sandra. Ihre Freund:innen gehen für Sandra einkaufen oder zur Apotheke, staubsaugen oder schieben ihren Rollstuhl, wenn Sandra das Haus verlassen möchte. Auch duschen kann Sandra nicht mehr alleine. „Haare waschen braucht so viel Energie, dass das mein Partner für mich übernimmt, damit ich die wenige Energie, die mir zur Verfügung steht, in Dinge investieren kann, die mir irgendwie Freude bereiten.”
Die Geldsorgen, die Sandra nun überrollen, betreffen die monatlichen Mietkosten genauso wie Ausgaben für Medikamente oder für unerwartete Rechnungen, etwa wenn ein Haushaltsgerät repariert werden muss. „Ich habe vor meiner Erkrankung gut verdient. Jetzt muss ich jeden Cent zweimal umdrehen”, fasst sie zusammen. Schon mehrmals haben ihr Freund:innen Geld für Besuche bei Ärzt:innen ausgelegt, auch die Österreichische Gesellschaft für ME/CFS half ihr bereits mit Geldspenden über die Runden.
Astrid Hainzl und ihre Kolleg:innen kennen zahlreiche solcher Geschichten. Seit Jahren versuchen sie, Änderungen in der Gesetzeslage zu erkämpfen, seit Jahren erfahren sie Ablehnungen.
Ein rechtlicher Kampf gegen Windmühlen
Erst im vergangenen Jahr reichten Astrid Hainzl und ihre Kolleg:innen einen Antrag im Gesundheitsministerium ein, in dem sie forderten, dass ME/CFS in die Liste jener Krankheiten aufgenommen wird, die als Basis für die Zuteilung eines Behindertengrades und damit der Zusicherung wichtiger Leistungen, wie Steuervereinfachungen, die Finanzierung von Rollstühlen und Lifteinbau oder personeller Unterstützung bei Arbeit, Schule und Studium gelten. Der Antrag wurde von zahlreichen Expert:innen und Organisationen unterstützt und auch seitens des Ministeriums für wichtig erachtet. Abgelehnt wurde er dennoch. Einzelne Symptome, so heißt es auf Nachfrage von ZIMT seitens des Gesundheitsministeriums, würden in der zugehörigen Verordnung zwar berücksichtigt, zureichend ist das Hainzls Meinung zufolge jedoch nicht, um das Unwissen der Ärzt:innen auszugleichen.
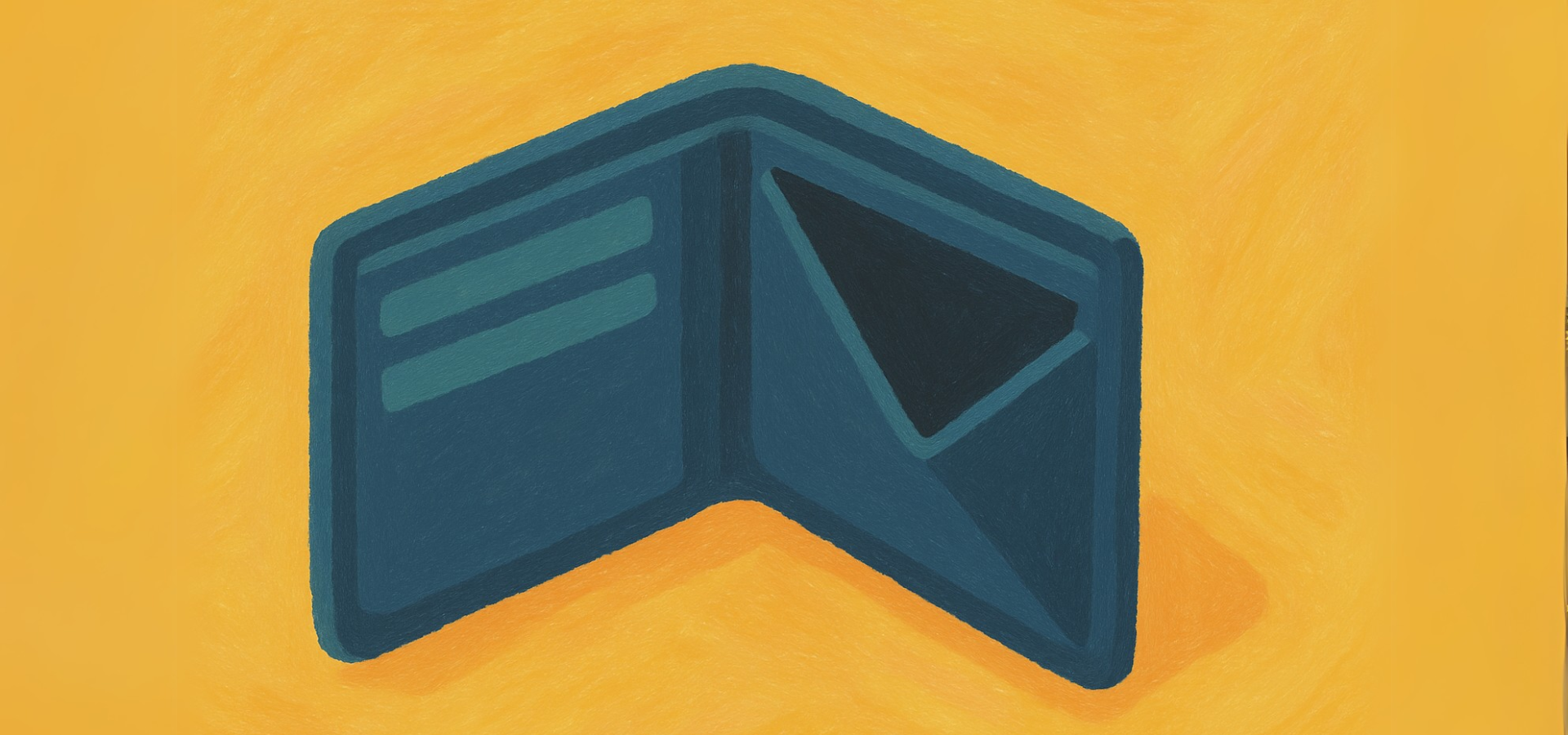
„Ich habe vor meiner Erkrankung gut verdient. Jetzt muss ich jeden Cent zweimal umdrehen”, sagt Sandra.
Auch die 2023 im Auftrag des Ministeriums erstellte Leitlinie zum Umgang mit Long Covid klammert ME/CFS aus, obwohl letzteres doch mehr als die Hälfte der Fälle darstellt. Das vertieft die Unsichtbarkeit der Krankheit weiter. „ME/CFS soll künftig besser berücksichtigt werden”, beschwichtigt das Gesundheitsministerium gegenüber ZIMT. „Im aktuellen Aktionsplan zur Behindertenpolitik ist vorgesehen, die Regelungen zu überarbeiten – gemeinsam mit der Österreichischen Gesellschaft für ME/CFS.”
„Immer, wenn es an ganz konkrete Schritte geht, scheitert es”, schlussfolgert Hainzl. „Wir werden wie eine heiße Kartoffel von allen Verantwortlichen im Kreis gereicht.” Die unterschiedlichen Kompetenzen und Zuständigkeiten im Gesundheits- und Sozialsystem erschweren es, Ansprechpartner:innen zu finden, die sich verantwortlich fühlen. „Wir hören oft: ‘Wir können nicht bei der sozialen Absicherung anfangen, wenn es nicht einmal medizinische Strukturen gibt.’ Egal wo, wir fangen an der falschen Seite an.”
Die ständigen Rückschläge hinterlassen Spuren bei Sandra. In die Zukunft blickt sie längst voller Sorge: Rechtsruck, weitere drohende Kürzungen im Sozialbereich… Nicht nur Sandras Existenz, auch jene zehntausender anderer chronisch Erkrankter im Land, hänge letztlich von politischen Entscheidungen ab – das Wissen darum mache Angst.
„Ich habe immer gehofft, dass ich zu denen gehöre, die sich wieder erholen”, sagt Sandra heute. „Ich habe ignoriert, dass die Symptome immer schlimmer und immer mehr geworden sind.” Erst als sie nur noch mithilfe ihres Rollstuhls das Haus verlassen kann, fängt sie an, sich mit dem Gedanken abzufinden, dass sie vielleicht nie wieder ganz gesund sein wird. „Ich hatte Pech, wie alle anderen Betroffenen auch. Auch die nicht vorhandene soziale Absicherung hat nichts mit mir persönlich zu tun. Das hat System seit mehreren Jahrzehnten.”
Dann wird Sandra hoffnungsvoll: „Dagegen kann man aber gemeinsam etwas tun.” Seit ein paar Wochen nimmt die Niederösterreicherin ein neues Medikament. Es hilft ihr, für eine Weile konzentriert am Laptop arbeiten zu können. „Ich bin eine Schreiberin. Ich kann mich über Text ganz gut ausdrücken.” Wer weiß, was ihre Worte noch alles erreichen werden.
„ME/CFS ist keine seltene Erkrankung. Sie wird einfach nur unsichtbar gemacht.”
Quellen
-
Hoffmann, D.E. & Tarzian, A.J. (2001). The girl who cried pain: A bias against women in the treatment of pain. The Journal of Law, Medicine & Ethics, 29(1), 13-27 https://doi.org./10.1111/j.1748-720X.2001.tb00037.x
-
König, R. S., Paris, D. H., Sollberger, M., & Tschopp, R. (2024). Identifying the mental health burden in Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS) patients in Switzerland: A pilot study. Heliyon, 10(5), e27031. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e27031 PubMed
-
Rabady, S., Hoffmann, K., Aigner, M., et al. (2023). Leitlinie S1 für das Management postviraler Zustände am Beispiel Post-COVID-19. Wiener klinische Wochenschrift, 135(Suppl 4), 525–598. https://doi.org/10.1007/s00508-023-02242-z kris.kl.ac.at
- Shapiro, D. & Hayburn, A. (2024). Medical gaslighting as a mechanism for medical trauma: Case studies and analysis. Current Psychology. Advance online publication. https://link.springer.com/article/10.1007/s12144-024-06935-0
-
Sozialministerium Österreich. (o. D.). Long COVID. Abgerufen am 24. April 2025 von https://www.sozialministerium.gv.at/Themen/Gesundheit/Corona/long-covid.html sozialministerium.gv.at
-
Sozialministerium Österreich. (2024). Aktionsplan zu postakuten Infektionssyndromen (PAIS). Abgerufen am 24. April 2025 von https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=842&attachmentName=Aktionsplan_zu_postakuten_Infektionssyndromen.pdf
Diese Recherche ist in bezahlter Zusammenarbeit mit den Psychosozialen Diensten Wien entstanden.