Boys don’t cry
Männer und Gefühle – das können sie einfach nicht, heißt es oft. Aber ist das wirklich so? Oder erleben sie Männer einfach anders?
Text: Ania Gleich
Bilder: Jana Reininger da Rosa

Die Sonne schien grell, als Georg am offenen Grab stand und auf den geflochtenen Weidensarg starrte. Die Frau, die ihn praktisch großgezogen hatte, lag darin – zwar nicht seine leibliche Großmutter, aber die wichtigste Bezugsperson in seinem Leben. Während andere Trauergäste weinten, kämpfte Georg mit sich. Er wollte nichts fühlen, nichts zeigen. Doch als der Sarg abgesenkt wurde, brach es über ihn herein: „Beim Begräbnis meiner Oma habe ich das erste Mal erlebt, dass ich von einer Welle an Traurigkeit überwältigt wurde. Aber anstatt wie sonst mit Wut und Hass dagegen anzukämpfen und sie schön in der Bauchmitte zu verpacken, habe ich mir gedacht: Ich weine jetzt. Aus. Davor durfte ich nie weinen.”
Georgs Worte sind eindringlich. Sie klingen nach Befreiung, aber auch nach einer lebenslangen Last. Dabei ist seine Erfahrung kein Einzelfall: Männer dürfen oft nicht weinen – so die unausgesprochene Regel in einer Gesellschaft, die Stärke und Kontrolle als männliche Tugenden preist. Doch was passiert, wenn Trauer, Angst oder Verzweiflung keinen Raum bekommen?
Alles mündet in Wut
Georg Igler, heute 40 Jahre alt, wuchs in Wien auf und arbeitet als Sozialpädagoge in Niederösterreich. Schon als Kind spürte er bewusst, dass Trauer ein Teil seines Lebens wurde: „Der Beginn der Pubertät war für mich der Beginn der Trauer. Und das hat eigentlich nie wirklich aufgehört.“ Er erinnert sich daran, wie er unter Gleichaltrigen stand, die sorglos die ersten Abenteuer des Erwachsenwerdens erkundeten, während er innerlich von einer Schwere erdrückt wurde, die er nicht in Worte fassen konnte. Dieses Gefühl des Fremdseins, das er später als „Existenzschmerz“ beschreiben würde, wurde zu seinem ständigen Begleiter. Was in den fünfundzwanzig Jahren darauf folgte, beschreibt er als „eine Aneinanderreihung depressiver Zustände“, nur gelegentlich unterbrochen von Momenten des Glücks, die jedoch immer von Wehmut überschattet waren – nämlich darüber, dass die unbeschwerten Zeiten bald wieder vorbei sein würden.
Als Georg das erste Mal bewusst Trauer erlebte, griff er zu der einzigen Emotion, die ihm gesellschaftlich akzeptabel erschien. „Irgendwann kanalisieren sich alle deine Gefühle in Wut“, erklärt er. Immer wieder tobte Georg in seinem Kinderzimmer oder schlug mit der Faust gegen die Wand. Diese Handlungen wurden zu einem Ventil, gleichzeitig aber auch zu einer weiteren Last, denn Wut sei gesellschaftlich geächtet – besonders bei Männern:
„Nichts in einer Gesellschaft ist gefährlicher als ein destruktiv agierender Mann.“
Maximilian*, heute 30 Jahre alt, ist in Wien aufgewachsen, wo er auch lebt und als freier Lektor und Journalist arbeitet. „Ich war weniger jemand, der auf Trauer aggressiv reagiert hat, sondern jemand, der zugemacht hat“, erzählt er. In diesen Momenten verließ er Arbeit oder Uni und stürzte sich in Sport oder Musik, um den Druck abzubauen. Manchmal joggte er einfach los, bis seine Beine brannten und er den Kopf frei hatte, oder er setzte sich Kopfhörer auf und hörte stundenlang seine Lieblingssongs. Für Außenstehende wirkte das wie ein selbstgewähltes Verschwinden, doch für ihn waren es Phasen tiefster innerer Zerrissenheit. Er fühlte sich wie in zwei Richtungen gezogen: einerseits das Bedürfnis, sich anderen zu öffnen, andererseits die Angst, sie mit seinen Problemen zu belasten. Erst nach seinem Studium, vor fünf Jahren, begann er, sich intensiv mit Fragen der Emotionalität und Belastbarkeit auseinanderzusetzen.

Statt Trauer auszuleben, empfinden viele Männer lieber Wut. Das scheint gesellschaftlich akzeptierter als Tränen.
„Ich wurde 2018 mit einer mittelschweren Depression diagnostiziert und war deswegen zweimal in Therapie“, erzählt er. Beide Male fiel es ihm schwer, sich darauf einzulassen – nicht zuletzt, weil er dachte: „Es gibt Leute, denen es schlechter geht, die brauchen die Hilfe mehr als ich.“ Zwar sprach er im Freundeskreis über seine Depression, doch oft diente das eher dazu, Emotionen von sich fernzuhalten. „Ich habe kontrolliert, worüber ich spreche und was ich emotional aushalten kann.“ Diese bewusste Zurückhaltung gab ihm das Gefühl von Sicherheit und Kontrolle. „Männer trauern im Geheimen, sie sind innerlich mit dem Erleben befasst, aber äußerlich ist das nicht oder nur kaum erkennbar. Statt über ihren Kummer zu sprechen, machen sie ihn lieber mit sich selbst aus“, schreibt Trauerbegleiter Thomas Achenbach in seinem Buch Männer trauern anders. Ob durch Wut oder Schweigen – der Druck, emotional stark und kontrolliert zu wirken, prägt die Geschichten von Maximilian und Georg. Gleichzeitig wird deutlich, was Achenbach betont: Männer drücken Gefühle oft anders aus: „Die Fähigkeit, Gefühle durch das Tun auszudrücken, ist die vielleicht typischste männliche Ausdrucksform.“ Trauern Männer also anders?
Was ist überhaupt männliche Traurigkeit?
Der Begriff „männliche Traurigkeit“ beschreibt mehr als nur Trauer im klassischen Sinn. Konrad Peter Grossmann, Psychotherapeut und Autor von Psychotherapie mit Männern, verwendet den Begriff der male depression, um die Unterschiede in den depressiven Zuständen von Männern und Frauen zu erfassen. Laut ihm neigen Männer dazu, Emotionen wie Verzweiflung, Angst oder Ohnmacht zu verdrängen, da sie im Widerspruch zu traditionellen Rollenbildern stehen. Stattdessen greifen sie auf externalisierende Coping-Mechanismen wie Aggression, Rückzug oder den Missbrauch von Alkohol oder Drogen zurück. Diese Strategien kaschieren den Schmerz, verstärken jedoch langfristig die Isolation.
Thomas Achenbach beschreibt Trauer als einen Sammelbegriff für eine Vielzahl von Gefühlen, die in der männlichen Sozialisation oft keinen Platz finden. „Es gibt im Deutschen ja kein Wort für Schmerz-und-gleichzeitig-Lähmung-und-gleichzeitig-Aufruhr-und-gleichzeitig-Verzweiflung-und-gleichzeitig-Verkriechenwollen-und-gleichzeitig-Aufbäumen-und-gleichzeitig-Angst-und-gleichzeitig-Wahnsinn… Wobei, doch, es gibt eines. Es wird nur selten dafür benützt. Das Wort heißt: Trauer.“
Beide Perspektiven zeigen: Trauer und Leidenszustände bei Männern sind häufig von gesellschaftlicher Tabuisierung geprägt. Sie werden verdrängt – mit oft destruktiven Folgen.
Männliche Suizide sind erschreckend häufig: Eine Studie des österreichischen Gesundheitsministeriums aus dem Jahr 2023 zeigt, dass mehr als drei Viertel der Suizide von Männern begangen werden. Ihre Methoden sind oft gewaltsamer als die von Frauen, was auf eine tiefere Verbindung zwischen unterdrückten Emotionen und destruktivem Verhalten hinweisen mag.
Wenn das männliche Vorbild fehlt
Georgs Kindheit war geprägt von einem abwesenden Vater und einer Familie, in der männliche Vorbilder fehlten. „Mein Vater war abwesend, und wenn er da war, hat er sich zwar ansatzweise bemüht, aber nicht mit mir umgehen können“, erzählt er. Diese Distanz zog sich durch Generationen: Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es in seiner Familie eine lange Linie alleinerziehender Mütter und (emotional) abwesender Väter. Georgs Vater etwa wuchs bei einer Mutter auf, die ihn aus gesellschaftlichem Druck in ein Internat gab, nachdem der leibliche Vater – ein französischer Besatzungssoldat – die Familie verlassen hatte. Als Georg erwachsen war, gestand sein Vater, dass er seinen Sohn immer für „anders“ gehalten habe, als er selbst war, und deshalb nicht mit ihm umgehen konnte.
Seine Mutter, die durch die Abwesenheit des Vaters zuhause das Sagen hatte, vermittelte ein klares Credo: Wer Gefühle zeigt, ist schwach und wer schwach ist, kann sich nicht beschützen. Der Glaube daran, dass Schwäche wertlos sei, durchdrang den Alltag. Selbst in Momenten, in denen Georg innerlich zu kochen begann, durfte er sich keine Schwäche erlauben. Wurde er wütend, musste er seine Emotionen herunterschlucken, bis er irgendwann keine andere Option mehr sah, als zu explodieren. Seine engsten Bezugspersonen bestärkten ihn indirekt in diesem Verhalten, indem sie immer wieder betonten, dass ein „richtiger Mann” Probleme mit Härte und Kontrolle löst.
Auch Thomas Achenbach beschreibt, wie Jungen in den Jahrzehnten nach den Weltkriegen lernten, ihre Gefühle zu verdrängen, da Nähe und Zärtlichkeit als weich galten. Diese emotionalen Vermeidungsstrategien wurden über Generationen weitergegeben, beeinflusst durch Ideologien, wie die der NS-Erziehung, die gezielt Härte und Gefühlsunterdrückung propagierte. Bücher wie Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind von Johanna Haarer forderten, dass Kinder „abgehärtet“ werden – Schreienlassen, Liebesentzug und körperliche Distanz galten als Erziehungsideale. Bindungsforscher wie Karl Heinz Brisch weisen darauf hin, wie tief diese Prinzipien bis heute in Familien wirken: Statt Vertrauen in die Welt zu fassen, verankert sich bei Kindern oft eine Urangst gegenüber ihrer Umwelt. Dieses Misstrauen prägt Beziehungen und die Fähigkeit, Gefühle zu zeigen, nachhaltig. Die Tradition der emotionalen Kälte zeigt sich nicht nur in familiären Strukturen, sondern spiegelt sich auch im gesellschaftlichen Umgang mit Männlichkeit wider – ein Erbe, das nach wie vor in uns nachwirkt.
Oder wie Žiga Jereb, Obmann der Männerberatung Wien, sagt: „Ich glaube, dass sich Männer viel weniger spüren und dass genau dieses Sich-spüren der Knackpunkt ist. Wenn ich Dinge wie Trauer, Ekel und Scham zuzulassen beginne und mich nicht sofort versuche zu betäuben oder die Gefühle zu verdrängen, dann ist schon viel geschafft.”

Kleinen Jungen wurde über Jahrzehnte beigebracht, dass sie nicht weinen dürfen. Entsprechende Rollenvorbilder fehlen.
Maximilian wuchs ebenfalls mit traditionell als männlich interpretierten Rollenbildern auf, die seine Gefühlswelt prägten. „Mit 17 habe ich dann angefangen, kritisch über Männlichkeit zu reflektieren, weil ich mich mit Feminismus beschäftigt habe“, sagt er. Doch obwohl er viele stereotype Verhaltensmuster ablegen konnte, blieb der Einfluss seiner Sozialisierung spürbar. „Es war frustrierend, zu sehen, wie viel ich internalisiert habe. Wenn es mir wirklich schlecht geht, versuche ich, das mit mir selbst auszumachen.” So wie er es einst bei seinem Vater gesehen hat, wenn dieser schweigend mit einem Buch im Wohnzimmer saß und Maximilian wusste, er solle ihn besser in Ruhe lassen, zieht auch er sich heute zurück, wenn es um die Verarbeitung schwieriger Gefühle geht.
Geht es nach Georg, liegt die Ursache des Problems in der vorgegebenen Rolle der Kernfamilie, denn diese führe dazu, dass der Vater berufstätig und die Mutter weitgehend alleine für die emotionale Versorgung zuständig ist. „Diese destruktive Dynamik ist Teil des Patriarchats und sie reproduziert sich immer wieder“, reflektiert er.
Aber auch die außerfamiliäre Kindererziehung spielt eine zentrale Rolle bei der Weitergabe solcher Muster. „Die Abwesenheit von Männern und von männlichen Vorbildern ist hierzulande nirgends größer als im Kindergarten“, schreibt Achenbach. Für Jungen bedeutet das oft, dass sie keine identifikatorische Grundlage für den Umgang mit ihren Gefühlen oder die Entwicklung eines als männlich gelesenen Ausdrucks von Emotionalität erleben. Stattdessen übernehmen sie häufig stereotype Rollenbilder, die sie aus anderen Quellen, wie der Popkultur, Medien oder dem familiären Umfeld, ziehen. Aber zwischen progressiven Konzepten einer neuen Männlichkeit und Figuren wie Andrew Tate, die alte, toxische Rollenbilder hypen, wird der Umgang mit Männlichkeit immer widersprüchlicher. Einerseits gibt es den Wunsch nach mehr emotionalem Raum, andererseits die Angst vor gesellschaftlicher Ächtung.
Ist Therapie nicht für Männer gemacht?
Obwohl Maximilians Mutter, eine Psychotherapeutin, ihn früh lehrte, dass Therapie etwas Normales ist, fiel es ihm lange schwer, Hilfe für sich selbst anzunehmen. „Für mich war der wichtigste Schritt zu sehen, dass Therapie kein Medikament ist, das ein Problem schnell löst, sondern ein Prozess, um ein bewussteres Leben zu führen.“ Rückblickend erkennt Maximilian, dass Therapie Introspektion und emotionale Distanz ermöglichen kann – beides wichtig, um alte Muster zu durchbrechen.
Georg hingegen steht der Gesprächstherapie kritisch gegenüber. Seine Erfahrung: „Die drei Jahre, in denen ich Therapie gemacht habe, waren für mich völlig sinnlos.“ Er erinnert sich an eine Sitzung zurück, in der er über seine Spinnenphobie sprach und die Therapeutin diese schnell auf seine Kindheit zurückführte, indem sie eine Verbindung zwischen weiblichen Spinnen und seiner „dominanten Mutter“ zog. Für Georg war das ein Bruchmoment: „Wie soll ich da andocken, wenn solche Schlussfolgerungen gezogen werden?“ Statt sich verstanden zu fühlen, fühlte er sich von vorgefertigten Schemata entkoppelt. Für ihn wirkte die Erklärung nicht nur zu konstruiert, sondern verfehlte auch den eigentlichen Kern seiner Angst.
Diese Erfahrung brachte Georg zum Nachdenken darüber, ob es immer sinnvoll ist, jede Angst oder Schwierigkeit mit der Vergangenheit zu verbinden. Er sieht Verdrängung nicht nur als Schwäche, sondern auch als eine männliche Strategie, um handlungsfähig zu bleiben. Aus seiner Sicht muss nicht jede verdrängte Erfahrung aufgearbeitet werden, insbesondere dann nicht, wenn sie die Gegenwart kaum beeinträchtigt. Genau hier hakt er bei klassischen Therapiekonzepten ein, die stark auf das Aufarbeiten der Vergangenheit setzen, ohne dabei immer den individuellen Kontext zu berücksichtigen.
Georg zieht Parallelen zur Humanmedizin, die lange auf Männern als Norm basierte, bis klar wurde, dass Frauen beispielsweise Herzinfarkte oft anders erleben. „Wenn das in der Medizin geht, warum nicht auch in der Psychotherapie? Männer brauchen manchmal andere Ansätze – und das sollte kein Tabu sein.“
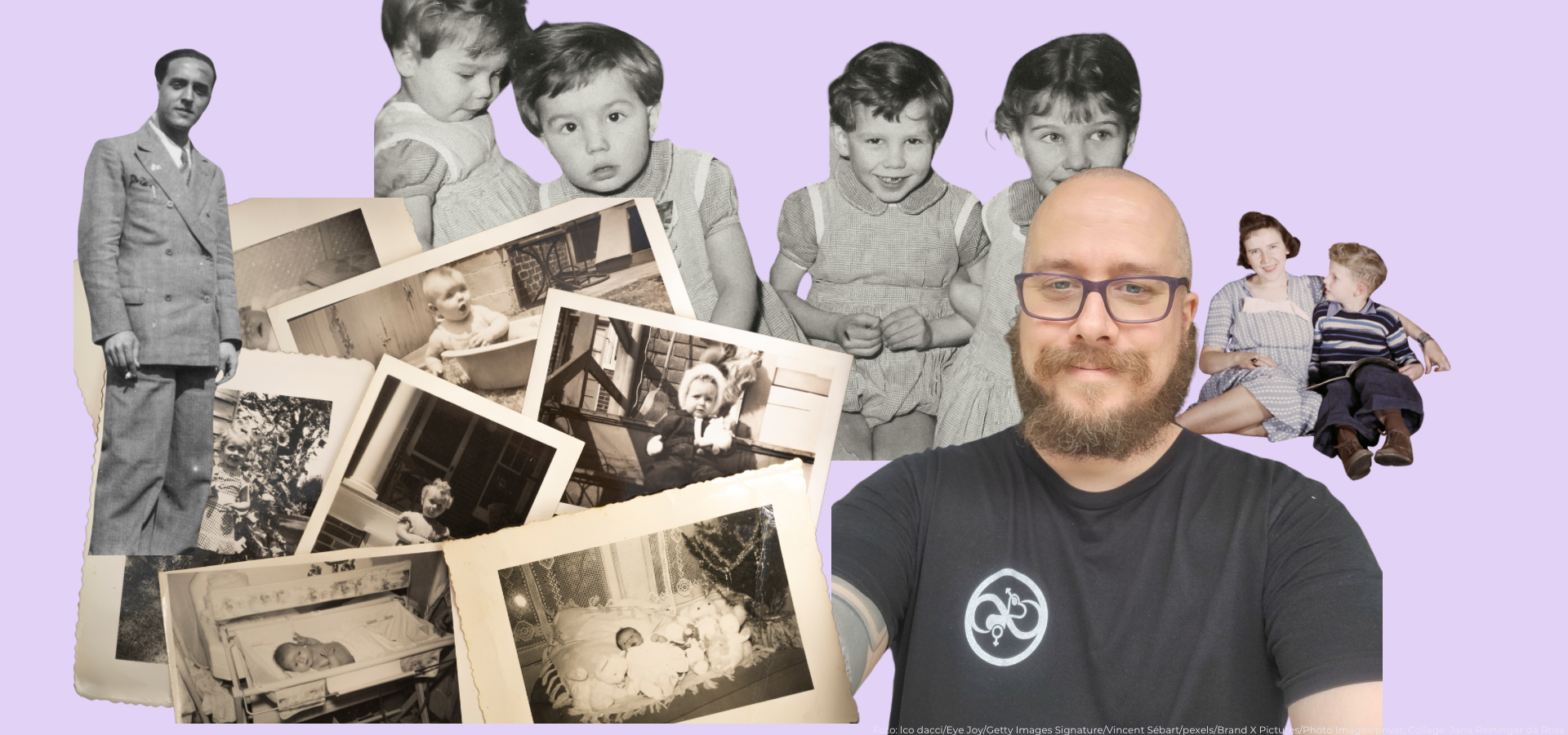
Bei der klassischen Gesprächstherapie wird der Blick auf die frühe Kindheit gerichtet. Für einen besseren Zugang sollte sie auch männliche Bedürfnisse in Betracht ziehen.
Dass Therapie für Männer oft eine Herausforderung ist, beschreibt auch Grossmann: Männer müssten Scham, Schwäche und Verletzlichkeit zeigen – alles, was ihre Sozialisation sie gelehrt hat, zu vermeiden. Auch Achenbach sieht das Dilemma: Angebote wie Trauercafés, also geschützte Orte, an denen sich Menschen in einer entspannten Atmosphäre bei Kaffee und Gesprächen treffen, um sich gegenseitig im Umgang mit Verlust und Trauer zu unterstützen, werden fast ausschließlich von Frauen besucht. Um Therapie zugänglicher zu machen, brauche es Räume, die auf männliche Bedürfnisse zugeschnitten sind – und ein Umdenken in den gesellschaftlichen Erwartungen an Männer.
Emotionales Erleben braucht Raum
Auch Žiga Jereb pocht auf die Erschaffung sicherer Räume und zwar solcher, in denen Männer lernen können, Gefühle zu benennen und auszudrücken. Emotionen, die nicht ausgelebt werden, stauen sich nämlich an, bis sie in Gewalt gegen andere oder sich selbst, bis hin zur Suizidalität, münden – ein Zusammenhang, der etwa in der Arbeit der HWR Berlin zu Männlichkeit und Suizidalität sowie auch in der Publikation der Frauenhauskoordinierung e.V. zu männlicher Sozialisation und Gewalt betont wird. „Gefühle zuzulassen ist etwas Wesentliches. Nur wenn ich mich selbst spüre, kann ich den anderen wahrnehmen und fürsorglich sein”, so Žiga Jereb.
Doch wo können Männer diese Räume finden, wenn gesellschaftliche Strukturen sie oft nicht bieten? Thomas Achenbach sieht etwa in Musik oder Sport versteckte emotionale Räume für Männer. Dort, wo kollektive Emotionen wie Fangesänge im Fußballstadion oder bei Konzerten erlaubt sind, finden Männer eine Ventilfunktion, die ihnen im Alltag oft fehlt. Doch diese Momente bleiben flüchtig.
Stetige emotionale Räume hingegen fanden Georg und Maximilian selbst. Nach einer schwierigen Phase suchte Maximilian bewusst nach einem Ort, an dem er offen über seine Erfahrungen und Zweifel sprechen konnte. Er fand ihn in einer Gruppe für kritische Männlichkeit, die sich mit den Auswirkungen traditioneller Rollenbilder und den damit verbundenen Erwartungen auseinandersetzt. Die Gruppe half ihm, seine Prägungen aus der Kindheit und Jugend besser zu verstehen und zu erkennen, wie er oft Herausforderungen aus dem Weg ging, um unangenehme Gefühle zu vermeiden. „Ich habe gelernt, diese Muster zu hinterfragen und neue Wege zu finden, mit meinen Emotionen umzugehen“, erzählt er. Die Atmosphäre der Gruppe, geprägt von Offenheit und gegenseitigem Respekt, gab ihm die Sicherheit, alte Denkweisen loszulassen und eine neue Perspektive auf sich selbst und seine Beziehungen zu entwickeln. „Es war erleichternd festzustellen, dass andere ähnliche Erfahrungen machen“, sagt er.
Georg beschreibt, wie er erst durch S.O.U.L., einem Verein, der sich für die Förderung sozialer Offenheit, liebevoller Gemeinschaft und sexpositiver Räume einsetzt, echte emotionale Verbindungen zu anderen Männern aufbauen konnte. Nach der Trennung von seiner Exfrau suchte er nach neuen Wegen, mit seinen Gefühlen umzugehen, und stieß auf den Verein. „Das wirklich wichtige emotionale Wachstum und echte Freundschaften habe ich erst dort gefunden“, reflektiert er. S.O.U.L. bot ihm einen Raum, in dem er nicht nur Unterstützung erfuhr, sondern auch lernte, sich emotional verletzlich zu zeigen, ohne dafür bewertet zu werden. Als es Georg an einem Tag schlecht ging, schrieb ihm ein Vereinsmitglied: „Ich werde alles, das in meiner Macht steht, dafür tun, für dich da zu sein.“ Als sie sich später trafen, erlebte Georg genau das, was er sich gewünscht hatte: kein erzwungenes Reden, sondern das Gefühl, gehalten zu werden – auf eine Weise, die ihm früher fremd war.
Gesellschaftliche Veränderung beginnt im Privaten
Georg und Maximilian zeigen, dass Veränderung möglich ist – durch Gespräche, Vorbilder und Räume, die Männer ermutigen, sich mit ihren Gefühlen auseinanderzusetzen. Georg, der früher Wut und Rückzug als Strategien kannte, vermittelt seinem Sohn heute die Wichtigkeit, Gefühle zuzulassen: „Ich sage meinem Sohn: Es ist wichtig, über Gefühle zu sprechen, damit die Wut erst gar nicht so stark werden kann.“ Diese Form der Begegnung findet auch Žiga Jereb wichtig:
„Der Diskurs sollte miteinander stattfinden. Aber dafür brauchen Männer auch ein Gegenüber, das weder vermeidend, noch abwertend auf Gefühle reagiert. Es muss möglich sein, einfach reden zu können.”
Die Veränderungen beginnen bei Einzelnen, doch sie entfalten ihr Potenzial erst in einer Gesellschaft, die Emotionen für alle Geschlechter enttabuisiert. Nur so können patriarchale Strukturen aufgebrochen werden, die nicht nur Frauen einschränken, sondern auch Männer belasten. Wie Achenbach treffend beschreibt: „Männer gehen mit dem Verstand an Themen wie Trauer und Verzweiflung heran, sie wollen Wissen sammeln.“ Doch echte Veränderung erfordert mehr als das – Gefühle müssen nicht nur sortiert, sondern gelebt werden können: „Wenn man Männern helfen will, braucht es klare Worte: Lass es raus, lass es zu.“
*Name von Redaktion geändert
Weiterführende Informationen
- Achenbach, Thomas: “Männer trauern anders”, 2019 (Patmos Verlag)
- Grossmann, Konrad Peter, “Psychotherapie mit Männern”, 2016 (Carl-Auer Verlag)
- Suizid und Suizidprävention in Österreich, Bericht 2023 (Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz)
Hilfs- und Unterstützungsangebote findest du hier:
Männerberatung Wien: www.maenner.at oder 01 603 2828
Männernotruf (0–24 Uhr, kostenlos): 0800 246 247
Suizidprävention: https://www.gesundheit.gv.at/leben/suizidpraevention.html