Triggerwarnung
Der Artikel befasst sich mit dem Thema Depressionen. Bestimmte Inhalte oder Wörter können negative Gefühle oder Erinnerungen auslösen. Wir möchten dich darauf hinweisen, den Artikel nicht zu lesen, falls du dich heute nicht stabil genug fühlst.
Das vergessene Geschlecht?
Frauen und Männer haben unterschiedliche psychische Belastungen. Wird das in der Behandlung ausreichend beachtet?
Text: Jana Reininger und Karina Grünauer
Fotos: Jana Reininger und Guilherme da Rosa
Illustration: Sabrina Haas
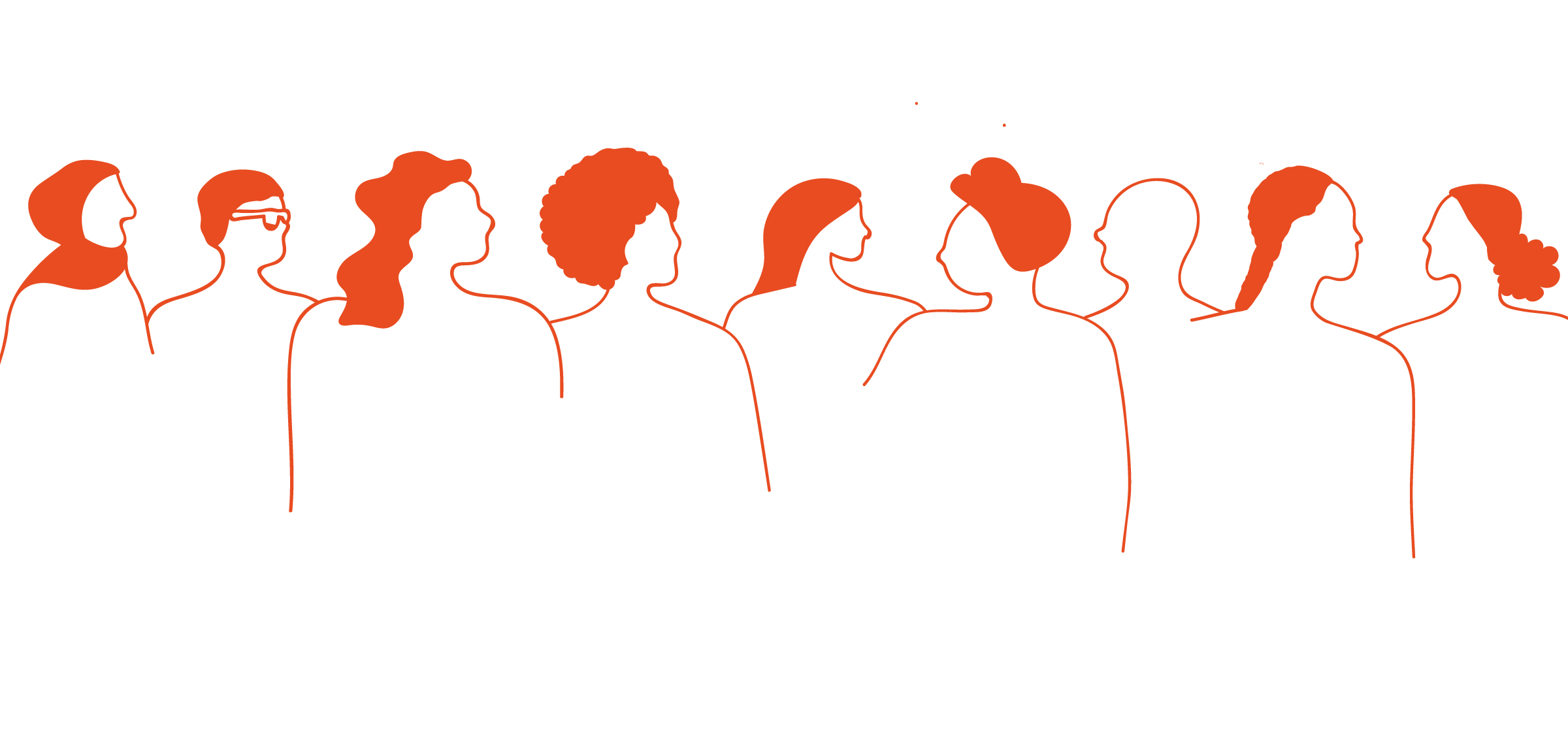
Als Alessandra mit 30 schwanger wird, steht eines fest: Der Job muss weg. In den vergangenen Jahren arbeitete Alessandra in einem Fotolabor. Jeden Tag stand sie dafür in einem Raum, in dem sie Filme in eine Entwicklungsmaschine legte. Erst war der Raum, in dem sie stand, 70m² groß. Damit verteilten sich die streng riechenden Stoffe ganz gut. Dann zog das Labor um und war fortan nur noch 30m² groß. Alessandra stieg jeden Tag Geruch in die Nase, der mit Sicherheit nicht gesund war, wie sie findet. Für sich alleine hat sie die Gesundheitsrisiken noch in Kauf genommen. Für das Baby, das nun in ihr heranwächst, nicht.
Alessandra kündigt. Sie geht in Karenz. Das erste Jahr lang ist Alessandra alleine mit ihrer Tochter zuhause. Sie geht durch die Wohnung und wiegt das schreiende Kind hin und her. Nachts steht sie im Stundentakt auf, borgt ihre Brust her, wann immer das Kind Hunger hat. Alessandra hat keine Zeit für eigene Bedürfnisse, für sich selbst, für Freund:innen oder für Entspannung. „Für ein Jahr hab ich mein Leben auf stumm geschalten“, sagt sie. Alessandra ist erschöpft. Sie hat keine Zeit für Erholung, für Freund:innen und auch nicht für sich selbst. „Was muss, das muss“, sagt sie sich und so vergehen die Monate.
Was Alessandra erlebt, ist für viele das Normalste der Welt. Aber eben nur für viele und nicht für alle, denn: Männer kümmern sich bei weitem nicht so viel um ihre Kinder, wie Frauen das tun. Mütter sind durchschnittlich eineinhalb Jahre lang mit ihrem Kind zuhause. Unter Männern geht durchschnittlich nur jeder fünfte in Karenz – und das dann auch nur für drei Monate, wie eine Studie der Arbeiterkammer aufzeigt.
Alessandra in ihrem Atelier
Die Lebensrealitäten von Männern und Frauen unterscheiden sich. Das hat Auswirkungen auf ihr psychisches Wohlergehen. Wer etwa sein „eigenes Leben auf stumm schaltet“, wie Alessandra das tut, hat keinen Raum für Self Care. Dementsprechend unterscheiden sich auch psychische Belastungen von Frauen und Männern – und die Weise, in der sie ausgelebt werden. Aber was bedeutet das konkret? Und werden die Folgen in der Behandlung psychischer Krisen auch angemessen beachtet?
Nur noch Mama sein
Schon ihr ganzes Leben lang quälen Alessandra depressive Episoden. Immer wieder mal liegt sie für zwei Wochen flach, bekommt keinen Bissen runter und denkt auch ab und zu an Suizid. Irgendwann entscheidet Alessandra sich für Therapie. Sie arbeitet an sich und daran, wie man Grenzen wahrt. Mit der Zeit fängt sie an, sich besser zu fühlen. Sie lernt den zukünftigen Vater ihres Kindes kennen und verliebt sich. Das Paar heiratet. Mit Depressionen haben beide Erfahrung. Wenn es ihrem Mann schlecht geht, nimmt Alessandra Rücksicht auf ihn. Dann spricht sie ruhig mit ihm und plant gemeinsame Ausflüge, um ihn ein wenig aus der Reserve zu locken.
Nach einer Weile wird Alessandra schwanger. Damit geht es ihr nicht sonderlich gut. Sie sehnt sich nach jemandem, der:die sich um sie kümmert, so wie sie es für andere tut. Doch der Wunsch wird ihr nicht erfüllt. Als Alessandras Tochter Emma auf die Welt kommt, ändert sich ihr Leben schlagartig. „Ich war plötzlich aktiv und positiv und hatte auch keine Depressionen mehr“, erzählt sie. „Ich hab auch nicht mehr bis elf oder zwölf geschlafen.“ Die Stimmung ihres Mannes ändert sich nicht. Zwischen Stillen und Wiegen und Wickeln hat Alessandra hat keine Zeit mehr, auf ihn Rücksicht zu nehmen. Das Paar trennt sich. „Wir sind jetzt beste Freunde, wir sehen uns jeden Tag, auch weil Emma das Gefühl von Zusammengehörigkeit und Familienleben braucht.“ Emma bleibt bei Alessandra, übernachtet regelmäßig bei ihrem Papa.
Als Emma keine zwei Jahre ist, kommt sie in den Kindergarten. Erstmal für ein oder zwei Stunden am Stück. Aber die sind für Alessandra viel wert. Sie sind die ersten Stunden, die Alessandra nach langer Zeit wieder für ihre eigenen Bedürfnisse, für Selbstfindung und Selbstfürsorge hat.
Alessandra fängt an zu fotografieren und findet in ihr eigenes Leben abseits der Mutterschaft zurück. Sie mietet erst einen Platz in einem Atelier und gründet dann ihr eigenes. Alessandra spricht wieder mit Erwachsenen, hat Raum für Kreativität und Ruhe, darüber nachzudenken, was sie eigentlich selbst braucht. Das ist wichtig, gerade für jemanden, der schon Erfahrungen mit Depressionen hat.
„Das war eine große Erleichterung“, sagt Alessandra. Aber sie muss sich Vorwürfe anhören – von Verwandten und von Fremden. Sie könne das Kind doch nicht über Nacht zu ihrem Vater bringen, sagen die Einen. Das Kind sei doch noch zu jung für den Kindergarten, sagen die Anderen. Die Aussagen machen Druck. Alessandra versteht nicht. „Es ist doch auch für Emma besser, wenn ich mich für ein paar Stunden erholen kann, es mir dadurch besser geht und ich dann auch mit ihr geduldiger bin“, sagt Alessandra verständnislos.

Alessandra in ihrem Atelier
Frauen erledigen den Großteil der Sorgearbeit – das belastet ihr psychisches Wohlbefinden
„Frauen haben eine hohe psychosoziale Belastung“, sagt Brigitte Schigl. Schigl ist Psychotherapeutin und forscht an der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften zu den Bedeutungen von Geschlecht in der Psychotherapie. Frauen schupfen die Arbeit, den Haushalt und kümmern sich gegebenenfalls um die Kinder – letzteres um einiges mehr, als Männer das tun, wie die letzte Zeitverwendungsstudie aus den Jahren 2008 und 2009 aufzeigt. Auch in der Erwerbstätigkeit übernehmen Frauen die Verantwortung über das Wohlbefinden anderer: Sie erledigen einen Großteil der Betreuungs-, Pflege- und Gesundheitstätigkeit, wie beispielsweise der Österreichische Arbeitsmarktservice berichtet. Seit der Pandemie haben sich die Ungleichheiten noch verstärkt. Das berichten beispielsweise die deutschen Wissenschaftlerinnen Kohlrausch und Zucco in ihrer Studie vom vergangenen Jahr.
Jeden Tag geht Rita zur Arbeit und spricht dort mit Menschen, die Unterstützung brauchen. Die Menschen, die vor ihr sitzen, sind unterschiedlich. Mal sind es junge Männer, die schon viel vom Leben gesehen haben. Mal sind es ältere Frauen, die frische Trennungen hinter sich haben. Mal sind es Familienväter, deren Sorgen sich in Falten in ihr Gesicht gemalt haben. Mal sind es junge Leute, fast noch Kinder, die sich ihr Leben, so wie es ist, gar nicht selbst ausgesucht haben.
In ihrer Arbeit unterstützt Rita Menschen mit Wohnungsproblemen. Manche haben ihre Wohnungen verloren, anderen droht die Wohnungslosigkeit. Die Sorgen der Menschen sind groß. Wenn Rita in der Arbeit ist, muss sie stark sein. Auch an schlechten Tagen sitzen meist Menschen vor ihr, die noch viel schlechtere Tage haben, als sie. In ihrer Arbeit ist Empathie Ritas größtes Gut. Rita ist geduldig, steht stets tatkräftig beiseite, den freundlichen Tonfall verliert sie nicht, die zuversichtlichen Worte auch nicht.
Rita ist 28 Jahre alt, als sie ein Burnout erlebt und an einer Depression erkrankt. Die Anforderungen an sie verstärken sich durch die Pandemie. Wohnen wird weniger leistbar und Ritas Klient:innen haben immer mehr Sorgen. Rita bemüht sich, zu helfen, so viel sie kann. Durch die Verantwortung für die existenziellen Probleme anderer Menschen ist der Druck auf Rita hoch. Sie ignoriert eigene Bedürfnisse und die Sorgen, die sie selbst während der Pandemie hat. Sie nimmt ihre Erschöpfung und ihre Depression nicht ernst. Rita distanziert sich zunehmend von ihren Freund:innen, fühlt sich gleichzeitig einsam und unverstanden und entwickelt Gedanken an den Tod.
„Ich mag den englischen Begriff Mental Load ganz gerne“, sagt Flora Löffelmann, die an der Uni Wien zum Thema Gender forscht. „Weil er schon ausdrückt, dass die Belastungen von Frauen Auswirkungen auf die Psyche, auf das Mentale, haben.“ Frauen haben viel zu tun und an viel zu denken. „Sie leisten emotionale Arbeit für alle anderen um sich herum und haben selbst keinen Raum, um sich um eigene Bedürfnisse und die eigene psychische Gesundheit zu kümmern“, erklärt die Wissenschaftlerin. „Frauen vereinbaren oft Arzttermine für die ganze Familie, kümmern sich darum, dass sich jede:r Angehörige wohl fühlt und bleiben dabei selbst auf der Strecke.“ Einfach, weil gesellschaftliche Rollenvorstellungen das schon lange von Frauen erwarten.
„Dass Care Arbeit überwiegend von Frauen übernommen wird, ist ein gravierendes gesellschaftliches Problem”, sagt auch Beate Wimmer-Puchinger, die Präsidentin des Berufsverbandes Österreichischer PsychologInnen. Ginge es nach ihr, würde die Sorgearbeit zunehmend von den Schultern der Frauen genommen. Würden sich Väter mehr in die Betreuung ihres Nachwuchses einbringen, wäre das nicht nur für die psychologische Entwicklung ihrer Kinder förderlich. Auch würde die Möglichkeit zur Gleichberechtigung unterstützt, weil Frauen sich auch mehr auf die Erwerbstätigkeit fokussieren könnten, wo sie immer noch doppelt so viel leisten müssten wie Männer, um überhaupt wahrgenommen zu werden, so Wimmer-Puchinger. Dieser doppelte und dreifache Erwartungsdruck sei ein weiterer Belastungsfaktor im Alltag von Frauen. Doch die Psychologin bleibt pessimistisch: „Solange es den Gender Pay Gap gibt und Männer um 14% mehr verdienen als Frauen, wird sich daran nur schwer etwas ändern lassen.”
Krankheitsbilder sind bei Männern und Frauen unterschiedlich (bewertet)
„Frauen erhalten öfter die Diagnose Depression“, sagt Brigitte Schigl. Tatsächlich sei aus wissenschaftlicher Perspektive aber unklar, ob Frauen auch wirklich häufiger an Depressionen erkrankt sind. Es werde etwa darüber diskutiert, ob Männer und Frauen Depressionen unterschiedlich ausleben – und die Krankheit demnach in unterschiedlichem Ausmaß erkannt wird, erklärt die Therapeutin und Forscherin. Flora Löffelmann fügt hinzu: „ADHS ist ein Beispiel dafür, dass Dinge unterschiedlich diagnostiziert werden, je nachdem, welches Geschlecht eine Person hat.“ Lange habe ADHS nämlich als männliches Phänomen gegolten, weiblich gelesene Menschen würden demnach auch weniger diagnostiziert und behandelt. „Frauen werden aber auch mehr dazu erzogen, sich ruhig zu verhalten und verstecken ADHS folglich vermutlich besser“, erklärt Flora Löffelmann. Bereits im Jahr 1970 stellte ein Forscher:innenteam rund um die Wissenschaftlerin Inge Broverman fest, dass Männer und Frauen in ihrer psychischen Gesundheit unterschiedlich bewertet werden.
Unabhängig von unterschiedlichen Bewertungen ist Schigl sich aber in zwei Dingen sicher: Gesellschaftliche Schönheitsideale und ein ungesundes Streben nach Perfektion führen für Frauen vermehrt zu Essstörungen – und weil sie mehr Gewalt aus dem vertrauten Umfeld erleben, erleben sie auch öfter Posttraumatische Belastungsstörungen. Gerade durch letzteres entwickeln sich oft auch Symptome von Borderline-Störungen. Dann wechsle ihre Stimmung sehr schnell, es gehe ihnen schnell schlecht, sie tendieren häufig zu Selbstverletzungen oder suizidalen Gedanken.
Rita und Kater Bucki in ihrer Wohnung
Die Wissenschaft fokussiert den Mann – und vergisst oft auf andere Geschlechter
„Die medizinische Forschung ist einfach auf das typische Bild des weißen 70-Kilo-Mannes ausgerichtet“, sagt Flora Löffelmann. „Es hat beispielsweise lange gedauert, bis der Hormonhaushalt als beeinflussendes Element psychischer Gesundheit in Betracht gezogen wurde und klar wurde, dass es Unterschiede gibt, die auch in der Behandlung zu beachten sind.“
Das ist ein Problem. Denn, wenn nicht gendersensibel auf Differenzen eingegangen wird, kann für viele Menschen, die nicht den klassischen weißen 70-Kilo-Mann darstellen, in vielen Fällen keine richtige Diagnose gestellt werden – damit warten Menschen, die vom 70-Kilo-Mann abweichen, oft vergeblich auf richtige Behandlungen ihrer Erkrankungen.
Tatsächlich weichen vom typischen Bild des weißen 70-Kilo-Mannes viele ab: Frauen genauso wie Männer, die nicht der Körpernorm entsprechen, Menschen, die nicht weiß sind – und vor allem auch Menschen, die sich nicht jenem Geschlecht zugehörig fühlen, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Denn wenn vom weißen 70-Kilo-Mann gesprochen wird, wird üblicherweise von cis-Menschen, also jenen, die sich ihrem zugewiesenen Geschlecht konform fühlen, gesprochen. Nicht-binäre Menschen, Inter- oder Trans-Personen bekommen folglich noch häufiger keine korrekten psychologischen Behandlungen – und das, obwohl ihre psychosoziale Belastung laut Schigl umso höher ist. Weil die Fremdheit im eigenen Körper belastend ist, genauso wie der Transitionsprozess, den Trans-Personen erleben. Weil „Menschen, die gegen den Strom schwimmen müssen“ auch mehr Mikroaggressionen ausgesetzt sind – Kritik, unangenehme Blicken oder Kommentaren. Dadurch entstehen, so Schigl, umso leichter psychische Erkrankungen. Laut der Wissenschaftlerinnen Löffelmann besteht in diesem Bereich noch viel Aufholbedarf.
Geschlechterverhältnisse müssen in der Psychotherapie mitgedacht werden
Für Schigl ist es vor allem die Geschlechterzusammensetzung im psychotherapeutischen Kontext, die noch zu wenig beachtet werde. In der Therapie spiele vor allem auch die Beziehung zwischen Therapeut:in und Patient:in eine wichtige Rolle. Dementsprechend sei die Konstellation der Geschlechterverhältnisse im therapeutischen Setting zentral.
Oft funktioniere ein gleichgeschlechtliches Therapiesetting besser. Weil Frauen, Männer und nicht-binäre Menschen ihre jeweiligen Lebensrealitäten besser nachvollziehen können. Besonders dann, wenn es um Sexualität, Körperlichkeiten, Familie oder Partner:innenschaft gehe. „Als Frau kann ich nicht nachempfinden, wenn ein Mann darüber klagt, wie schlimm das mit seinem vorzeitigen Samenerguss ist. Und ein männlicher Therapeut wird zwar nachvollziehen können, dass es schlimm ist, wenn eine Frau nach einer Brust-OP nur noch einen Busen hat, aber eins zu eins nachvollziehen kann er es nicht.“ Genauso wenig, wie der Druck, den Frauen in Sorgetätigkeiten erleben oder die Erschöpfung von frischen Müttern, die nur noch für ihr Kind funktionieren. „Vielen Psychotherapeut:innen ist klar, dass Männer und Frauen unterschiedliche Lebensbedingungen haben. Aber für eine genderkompetente Psychotherapie reicht das alleine nicht. Wir Therapeut:innen müssen auch unsere eigene Geschlechtsidentitäten in den Blick nehmen. Mit all unseren Geschichten, Vorurteilen, und genderbedingten, gelernten Umgangsformen. Das ist dann Genderkompetenz und darin sind bisher nur wenige firm“, sagt Schigl. „Wichtig wäre, dass dieser Aspekt bereits in der Ausbildung von Psychotherapeut:innen viel stärker beachtet wird. Dass angehende Psychotherapeut:innen die Auswirkungen der Geschlechterverhältnisse von Anfang an mitreflektieren“, sagt Schigl.

Rita und Kater Bucki in ihrem Wohnzimmer
Neben Sorgearbeit wieder zu sich selbst finden
Zwei Mal in der Woche geht Rita zur Psychotherapie. Ihre Therapeutin kennt sie schon eine Weile. Die Gespräche mit ihr helfen und auch die Psychiaterin, zu der Rita nun geht, ist für Rita keine fremde Person. Beide Frauen haben ein offenes Ohr für ihre Sorgen. Sie nehmen sich Zeit und verstehen die Probleme und Sorgen, die Rita, wie so viele Frauen, hat. Rita fängt an, Medikamente zu nehmen. Sie geht in Krankenstand und ruht sich eine Weile aus. Dann fängt sie an, mit Ton zu arbeiten. Dabei kann sie ihre Anspannung verlieren. Sie kann Sorgen um die anderen gehen lassen und zu sich selbst finden. In dem Augenblick an der Tonscheibe zählt für Rita nur sie selbst. Das Leben wird besser.
Alessandra sucht einige Jahre nach einer:m passenden Therapeut:in. Mal hat die gewählte Therapeutin keine freien Plätze, mal ist der freie Platz zu teuer, mal passt die Chemie zwischen Therapeut:in und ihr nicht. „Therapeut:innen zu finden, ist sehr schwierig. Bis man wirklich mal eine:n findet, wo man sich wohlfühlt und wo man sich öffnen kann.” Alessandra gibt die Suche auf, sie fängt an, selbst all ihre Gedanken aufzuschreiben. Das hilft ihr. Was ihr auch hilft, ist die Geburt ihrer Tochter. „Es ist als ob sie mich zu einem positiveren Menschen gemacht hätte“, sagt sie heute. Weil Alessandras Zeit plötzlich begrenzt war und ihre Chancen ihr nicht mehr so unendlich erschienen, hat sie Dinge in die Hand genommen. „Ich hab schon mit zehn Jahren gewusst, dass ich Fotografin werden will. Ich hab es geplant und geplant und nie gemacht. Durch Emma hab ich es geschafft. Weil ich die wenige Zeit, die dann verfügbar war, einfach für mich genutzt habe.“

Foto der ZIMT-Ausstellung „Psyche & Frau“
Weitere Quellen zu Frau und Psyche
-
AMS. 2016. Frauen und Männer am Arbeitsmarkt https://bis.ams.or.at/qualibarometer/gender.php?id=94
- Broverman et al. 1970. Sex-Role Stereotypes and Clinical Judgements of Mental Health. In: Journal of Consulting and Clinical Psychology. 34. 1-7. https://psycnet.apa.org/record/1970-06951-001
- Der Standard. 2022. Die Pandemie als Belastungsprobe für Frauen https://www.derstandard.at/story/2000133568595/die-pandemie-als-belastungsprobe-fuer-frauen
-
Kohlrausch & Zucco. 2020. Die Corona-Krise trifft Frauen doppelt. https://www.boeckler.de/pdf/p_wsi_pb_40_2020.pdf
-
Moment. 2020. Väterkarenz: Was bringt das denn? https://www.moment.at/story/vaeterkarenz-was-bringt-das-denn
-
Springer Medizin. 2020. Frauenspezifische psychische Störungen in der Psychiatrie https://www.springermedizin.de/emedpedia/psychiatrie-psychosomatik-psychotherapie/frauenspezifische-psychische-stoerungen-in-der-psychiatrie?epediaDoi=10.1007%2F978-3-642-45028-0_89
- Spektrum Kompakt. 16.21. 2021. Gendermedizin. Wie das Geschlecht die Gesundheit beeinflusst https://www.spektrum.de/pdf/spektrum-kompakt-gendermedizin/1855609
-
Wienerin. 2010. Psychische Erkrankungen bei Frauen https://wienerin.at/psychische-erkrankungen-bei-frauen
Anlässlich des Weltfrauentages und auch, weil die Wissenschaft darüber hinaus wenig Information bietet, befassen wir uns in diesem Artikel vor allem mit Geschlechterbinarität. Im Sinne der einfachen Verständlichkeit, die wir benötigen, um Menschen aller Bildungshintergründe mit einzuschließen, sprechen wir hier von Frauen und Männern. Wir wollen damit keinesfalls Geschlechtervielfalt abstreiten und freuen uns über einen offenen Diskurs.



