Von lauten Bühnen und leisen Heilungen
Zwischen Festivalstimmung und Therapieraum: Über die unterschätzte Kraft von Musik – und was sie für unsere Psyche tun kann.
Text: Magdalena Frauenberger

Ein lauer Sommerabend, der letzte Sonnenstrahl taucht das Musikfestivalgelände in warmes Licht. Vor der Bühne tanzt und singt die Menge, während Annie, Bassistin und Sängerin der alternativen Rockband Leftovers, gemeinsam mit ihren Bandkollegen ihre neuen Songs performt. Diese Szene spielte sich im Sommer des vergangenen Jahres auf dem Poolbar Festival in Feldkirch, Vorarlberg, ab. Jedes Jahr wird hier Musik von Nischen bis Pop präsentiert. Der Auftritt der Leftovers fand in einem leeren Swimmingpool statt, einem zentralen Element des Festivals. Um die Band herum: freudige Gesichter der Zuhörer:innen, die in der Menge tanzen, die Lieder mitsingen und sich in den Moment fallen lassen.
Woran vor Ort sicher kaum jemand denkt: Solch ein Konzertbesuch dient nicht nur als unterhaltsames Freizeiterlebnis, sondern ist auch eine wissenschaftlich belegbare Form der mentalen Erholung. Studien zeigen, dass Musik das Gehirn beeinflusst. Genau deshalb werden Melodien und Klänge in der psychotherapeutischen und psychologischen Arbeit bereits seit langer Zeit eingesetzt. In den letzten Jahren hat die Musiktherapie zunehmend an Bekanntheit gewonnen, wird aber oft noch als simple „Musikstunde“ abgetan. Doch welche Auswirkungen hat Musik auf unser Gehirn? Wie beeinflusst sie unsere Psyche und unser Wohlbefinden?
Musik als Auszeit
Für Annie bedeutet Musik mehr als nur künstlerischer Ausdruck – sie ist ein zentraler Bestandteil ihres emotionalen Wohlbefindens. „Jedes Mal, wenn ich mit unserer Band auf der Bühne stehe, fühle ich eine immense Freiheit“, erzählt sie. Schon in ihrer Jugend entdeckte Annie die Tonkunst als Ventil, um mit ihren Emotionen umzugehen – immer dann, wenn sie besonders traurig, wütend oder auch sehr glücklich war. Das ist es, was sie mit ihrem Publikum verbindet.
Lea, ein begeisterter Fan der Leftovers, nutzt die Musik ebenfalls, um ihre Gefühle zu ordnen. „Konzerte bieten mir eine kurze Auszeit vom stressigen Studium“, erzählt die 21-Jährige vor dem Auftritt der Band beim Poolbar Festival. Besonders während der Corona-Lockdowns waren die Lieder der Leftovers ein starker Halt für sie. Auch die soziale Dimension von Live-Konzerten hebt Lea hervor: Das Mitsingen und Tanzen in der Menge schafft ein starkes Gefühl der Zugehörigkeit. Ein Freund, der sie am Konzertabend begleitet, teilt diese Ansicht: „Gemeinsam zu tanzen und zu singen ist ein tolles Erlebnis für unsere Freundschaft!“
Frühgeborene und ältere Menschen
Studien bestätigen, dass solche gemeinsamen Musikerlebnisse tatsächlich die Ausschüttung von Oxytocin fördern können – einem Hormon, das das Vertrauen zwischen Menschen erhöht. „Musik fördert das Gemeinschaftsgefühl und vertieft soziale Bindungen“, heißt es auf der Website der Deutschen Musiktherapeutischen Gesellschaft (DMtG). Auch die Musiktherapeutin in Ausbildung unter Supervision, Marie Winnecke, bestätigt die heilende Wirkung von Klängen und Melodien: „Musik ist toll. Sie hilft auf vielen verschiedenen Ebenen und in unterschiedlichen Lebenslagen“, erzählt sie im Interview für das ZIMT Magazin.

Die Leftovers nutzen die Musik auch als Ventil für Emotionen.
Marie Winnecke, die derzeit ihren Master in Musiktherapie an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien (MdW) absolviert, hat diese Wirkung erstmals während eines einschneidenden Erlebnisses auf einer Wachkomastation entdeckt. Als Blockflötenspielerin spielte sie dort zusammen mit zwei weiteren Musiker:innen ein speziell für die Patient:innen konzipiertes Konzert. Die Komposition, die sie aufführten, war eigens auf die Situation vor Ort abgestimmt. Während ihres Besuchs konnte Winnecke miterleben, wie sich der Blutdruck und die Herzfrequenz der Patient:innen unter der Musik veränderten. Das sei sogar direkt in der Mimik der Patient:innen sichtbar gewesen. „Ein beeindruckender Moment, der mir zeigte, was Musik alles bewirken kann“, so Winnecke. „Nach diesem Tag war ich mir sicher, dass ich Musiktherapie studieren möchte.“
Im Rahmen ihres Studiums konnte Winnecke bereits Erfahrungen in den verschiedensten Bereichen der Musiktherapie sammeln: von der Arbeit mit Frühgeborenen, die, wie eine Studie der Kepler Universität Linz zeigt, mithilfe einer musiktherapeutischen Behandlung verlängerte Tiefschlafphasen erleben, über die Kinder- und Jugendpsychiatrie bis hin zur Betreuung älterer Menschen auf Pflegestationen. Es gibt kaum eine Altersspanne, in der die Klangkunst nicht zum Einsatz kommt. „Meine jüngste Patientin war nicht einmal ein Jahr alt, die älteste Person war in ihren 90ern“, so Winnecke.
Auch die Anwendungsformen der Musiktherapie sind vielfältig, wie die Therapeutin erzählt. Klassische Methoden, wie sie in der „Wiener Schule“, der Forschungslinie der Musiktherapie, die traditionell in Wien unterrichtet wird, etabliert sind, setzen beispielsweise Trommeln ein, um tiefsitzende emotionale Blockaden zu überwinden. Der rhythmische Einsatz von Percussion-Instrumenten dient dabei als eine Art Ventil, durch das unterdrückte Gefühle an die Oberfläche gelangen können. Diese Methode fördert nicht nur den Ausdruck von Gefühlen, sondern auch das Loslassen von emotionalem Ballast.

Trommeln werden in der Musiktherapie beispielweise zur Lösung von emotionalen Blockaden eingesetzt.
Ein weiterer moderner Ansatz ist die Methode des therapeutischen Songwritings. Hierbei wird den Patient:innen die Möglichkeit geboten, starke Emotionen gezielt in Worte und Musik zu fassen, wie Marie Winnecke erklärt. In der Therapiestunde werden die Texte eines bereits bestehenden Songs umgedichtet – passend zu dem jeweiligen Thema, das die Patient:innen beschäftigt – oder es wird ein ganz eigenes Lied mit Text und Melodie verfasst. Dieser Prozess eignet sich besonders gut, um stark belastenden Gefühlen Ausdruck zu verleihen, und hilft, diese zu bewältigen.
Musik statt Antidepressiva?
Dabei passiert einiges mit Körper und Psyche: „Beim kreativen Schreiben werden biochemische Prozesse im Körper in Gang gesetzt“, erklärt die Neurowissenschaftlerin Yuko Koshimori 2018 im Oxford Handbook of Music and the Brain. „Neurotransmitter wie Dopamin und Serotonin werden ausgeschüttet. Diese Botenstoffe heben die Stimmung und erzeugen ein Gefühl von Erleichterung und emotionaler Befreiung. Dabei fördert Dopamin, bekannt als Belohnungs-Neurotransmitter, ein Gefühl von Freude und Motivation, während Serotonin beruhigend wirkt und hilft, die allgemeine Stimmung zu verbessern.“
Das erklärt, warum das Liederschreiben der Sängerin Annie wohl auch so guttut. „Die Idee zu einem Song kommt manchmal schleichend, oft aber auch ganz plötzlich, wenn mich eine Situation in meinem Leben besonders emotional berührt – traurig, überfordert oder aber auch besonders glücklich gemacht hat“, erzählt sie.
Dann schnappt sie sich eines ihrer vielen Notizbücher oder greift zu Bass oder Gitarre. „Meine tausend Notizbücher habe ich auch immer mit auf Tour dabei“, erzählt die Künstlerin. „Das analoge Schreiben macht mir aktuell besonders Spaß. Das inspiriert mich und befeuert meine Kreativität.“
„Das Schreiben von Songtexten ist eine gute Möglichkeit, sich schnell und effizient starken Emotionen anzunehmen, und eignet sich daher besonders gut in Situationen, in denen oft nicht viel Zeit zur Verfügung steht – zum Beispiel in psychiatrischen Kliniken, in denen stationäre Patient:innen zwar intensiv mit der Psyche kämpfen, jedoch nur für kurze Zeit vor Ort bleiben. Da gibt es oft nicht genug Zeit und Raum, um eine intensive Beziehung zwischen Therapeut:in und Patient:in aufzubauen, wie es etwa für eine erfolgreiche Gesprächstherapie nötig wäre“, erzählt Marie Winnecke. „Ein Tool wie das therapeutische Songwriting kann da hilfreich eingesetzt werden!“
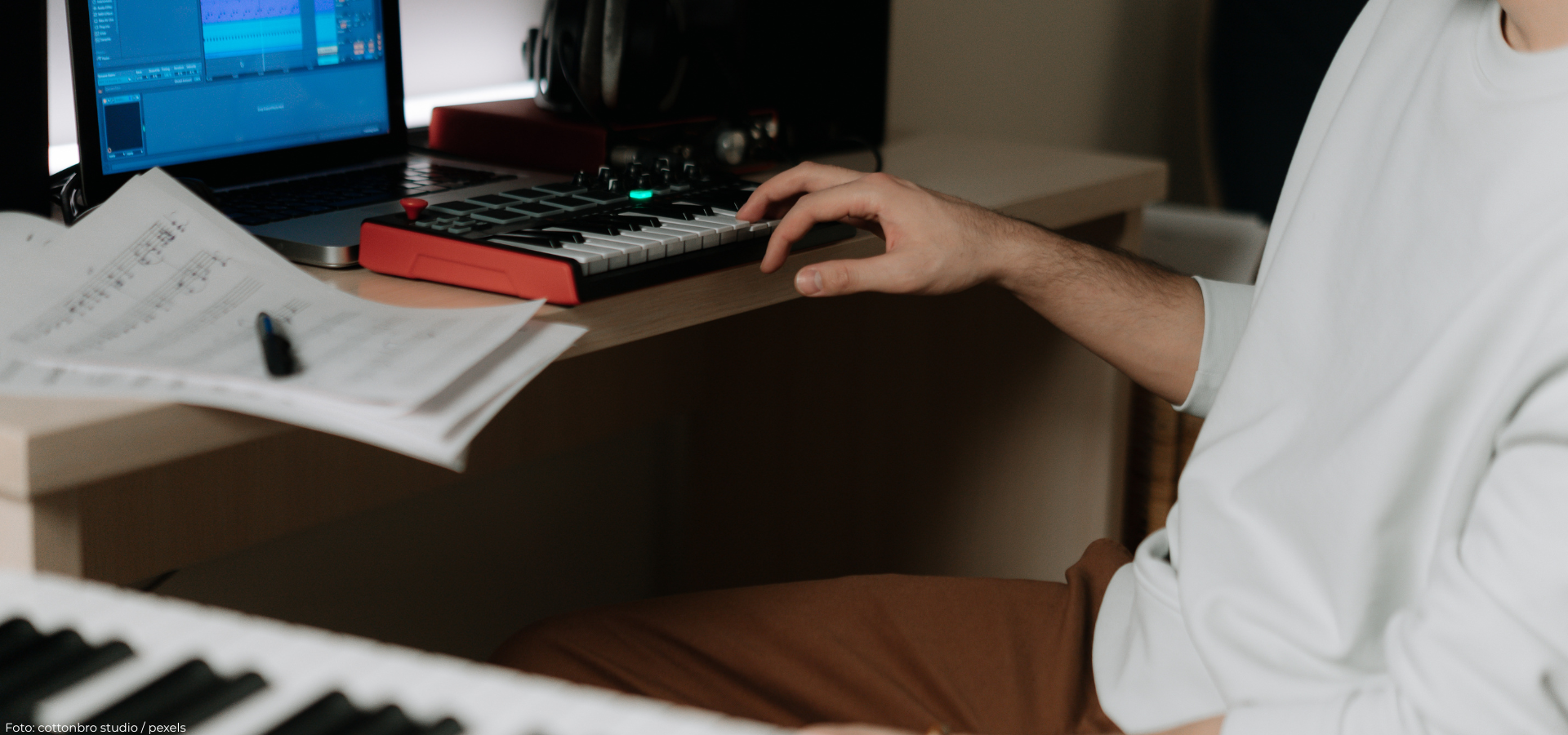
Wenn eine Situation einen im Leben besonders emotional berührt, kann es heilsam sein, einen Songtext dazu zu schreiben.
Auch bei einigen spezifischen psychischen Krankheitsbildern ist Musik eine ideale Therapieform. Untersuchungen deuten beispielsweise darauf hin, dass weißes Rauschen – vielen auch unter der englischen Bezeichnung White Noise bekannt – speziell bei Personen mit Aufmerksamkeitsdefiziten wie ADHS vorteilhaft sein kann. Weißes Rauschen hilft, weil es störende Reize übertönt und sich das Gehirn so besser auf Wichtiges fokussieren kann, wie Nicole Baum und Jasleen Chaddha in ihrer Studie von 2021 aufzeigen. Dabei wird bei den betroffenen Personen der Signal-Rausch-Abstand im Gehirn optimiert und dadurch die Verarbeitung relevanter Informationen erleichtert.
Melodien und Klänge können im Kontext von ADHS also durchaus Psychopharmaka ersetzen. Musik hilft zudem auch gegen Ängste. So verspüren immer mehr junge Menschen die sogenannte Climate Anxiety – eine Angst, die im Zusammenhang mit der Klimakrise und Umweltkatastrophen auftritt. Dies wiederum führt zu Ärger und Hoffnungslosigkeit und dazu, dass viele Personen im Kampf gegen die Klimakrise eher stagnieren, als aktiv zu werden. Im TED-Talk „Connecting to Climate Change through Music“ erklärt die Klimawissenschaftlerin Judy Twedt, dass Musik dabei helfen kann, wieder eine emotionale Verbindung und damit eine stärkere Involviertheit auf emotionaler Ebene zur Klimakrise zu schaffen.
Klänge gegen Alzheimer
Auch bei Alzheimer kann Musik generell einiges zur mentalen Unterstützung leisten: „Vertraute Melodien und Texte, insbesondere aus der Jugend, können autobiografische Erinnerungen und damit verbundene Emotionen hervorrufen“, erklärt Marlene Schneider, Assistenzärztin für Neurologie in Berlin. Einige Studien haben laut Schneider gezeigt, dass Menschen mit Alzheimer auch bei starker Gedächtnisbeeinträchtigung noch Emotionen durch Musik erleben können. Dies deutet darauf hin, dass das emotionale Gedächtnis für Musik bei Alzheimer relativ gut erhalten bleibt. Ein möglicher zugrunde liegender Mechanismus, so Schneider, sei der Rhythmus, der helfe, Informationen zu strukturieren und zu segmentieren. „Musik kann also als wertvolles Werkzeug zur Unterstützung des Gedächtnisses bei Menschen mit Demenzerkrankung dienen.“
Zurück zur Musiktherapie und zum therapeutischen Songwriting: Ist ein Text in der Therapiestunde fertig geworden, kann dieser auch mit nach Hause genommen werden. „Das stärkt nebenbei auch das Gefühl der Selbstwirksamkeit“, so die Therapeutin Marie Winnecke. „Manchen Patient:innen fehlt in der reinen Gesprächstherapie das Gefühl von Kontrolle und Selbstwirksamkeit – hier kann das eine wunderbare Ergänzung oder sogar ein Ersatz sein.“
So wie die Patient:innen mit ihren Texten etwas in der Hand haben, das sie aus der Therapie mitnehmen, nimmt auch Annie ihre Songideen mit – in den Proberaum. Dort jammen dann alle Mitglieder der Band gemeinsam und feilen am neuen Stück weiter. „Für mich hat ein Song eine ganz persönliche Bedeutung, die sich mit der Zeit auch verändern kann. Jede Person, die mein Musikstück, meine Kunst, rezipiert, hat aber wiederum ihre ganz eigene, individuelle Interpretation. Das finde ich richtig schön – dass meine persönliche Kunst Menschen jeweils ganz unterschiedlich berühren kann“, sagt Annie.

Die Bedeutung eines Songtexts ist für jede Person stark abhängig von eigenen Erfahrungen und Interpretationen.
Und das sieht auch Winnecke so: „Wenn wir Musik gezielt als Ressource in unseren Alltag integrieren, können viele Menschen – unabhängig von einer formalen Musiktherapie – von der positiven Wirkung der Klangkunst profitieren.“ Diesbezüglich gibt Winnecke auch noch einen praktischen Tipp zum Selbstausprobieren mit auf den Weg: „Es geht darum, für sich selbst herauszufinden, welche Musik einem besonders guttut – vor allem in Situationen, in denen man sich traurig, wütend oder hoffnungslos fühlt. Diese Lieder können dann gezielt eingesetzt werden, um das innere Gleichgewicht zu stärken.“ Manche Menschen steuern dabei bewusst gegen ihre Stimmung, indem sie fröhliche Musik in traurigen Momenten hören. Andere bevorzugen es, mit passender Musik ihre Gefühle intensiver zu durchleben.
Interessanterweise steuern ältere Menschen tendenziell häufiger gegen. Winnecke hat in diesem Kontext beispielsweise zusammen mit einer Freundin, die an Migräneanfällen leidet, eine Playlist erstellt, die für besonders schmerzhafte und emotional belastende Tage geeignet ist – ein Ansatz, der sich auch bei anderen Herausforderungen bewährt hat. „Jede:r hat einen Lieblingssong, der besonders berührt. Sich bewusst zu machen, warum das so ist, kann helfen, die eigenen Gefühle besser zu verarbeiten und das Wohlbefinden zu stärken.“