404 – Therapieplatz not found
Wer auf einen kassenfinanzierten Platz für Psychotherapie hofft, wartet oft lange. Antonia erzählt ihre Geschichte.
Text: Antonia*
Bilder: sketchify/Valeriia Postnikov

„Guten Tag,
Vielen Dank für Ihre Anfrage. Leider haben wir derzeit keine freien Therapieplätze und auch die Warteliste ist bedauerlicherweise voll. Ab wann wieder ein Platz frei sein wird, lässt sich zurzeit leider nicht sicher sagen.“
Auch wenn ich diese Worte so oder so ähnlich in den letzten Monaten mindestens ein dutzend Mal gelesen oder gehört habe, breitete sich ein flaues Gefühl in mir aus. In meinem Kopf wiederholte sich die Stimme der Telefonseelsorgerin, die ich während meines letzten Zusammenbruchs angerufen hatte: „Ihre Probleme sind doch heutzutage keine Probleme mehr. Da gehen Sie eben in Therapie und müssen vielleicht mal eine Tablette nehmen – aber sonst können Sie doch ganz normal weiterleben!“ Selbst in meinem desolaten Zustand machte mich diese Aussage so wütend, dass ich tatsächlich für einen Moment aus meiner Negativspirale herauskatapultiert wurde. Leider nicht für lang.
Spätestens seit mir in einer psychosozialen Beratungsstelle zu einer Therapie geraten wurde, ist mir klar, dass ich Hilfe brauche. Manchmal fühlen sich die Tage an, als laufe ich in Watte. Manchmal ist meine Bettdecke aus Blei und manchmal fängt mein Herz in einer vollen Bahn so heftig an zu schlagen, dass ich keine Luft mehr bekomme. Heute weiß ich meistens, warum. Meine Symptome wurden mittlerweile unter die Diagnose „posttraumatische Belastungsstörung“ gefasst – was das für mich genau bedeutet, weiß ich noch nicht. Was ich hingegen genau weiß, ist, dass ich diese allein nicht bewältigen kann.
Mit 14 hatte ich einen 21-jährigen Mann kennengelernt. Ich war sehr verliebt. Wie ich die Gefühle eines erwachsenen Mannes für mein damaliges, noch sehr kindliches Ich nennen würde, weiß ich nicht. Über das, was in den darauffolgenden Jahren passiert ist, spreche ich selbst mit meiner Therapeutin noch sehr zögerlich. Aber sie führten dazu, dass partnerschaftliche Nähe und Intimität für mich heute sehr schwierig sein können.
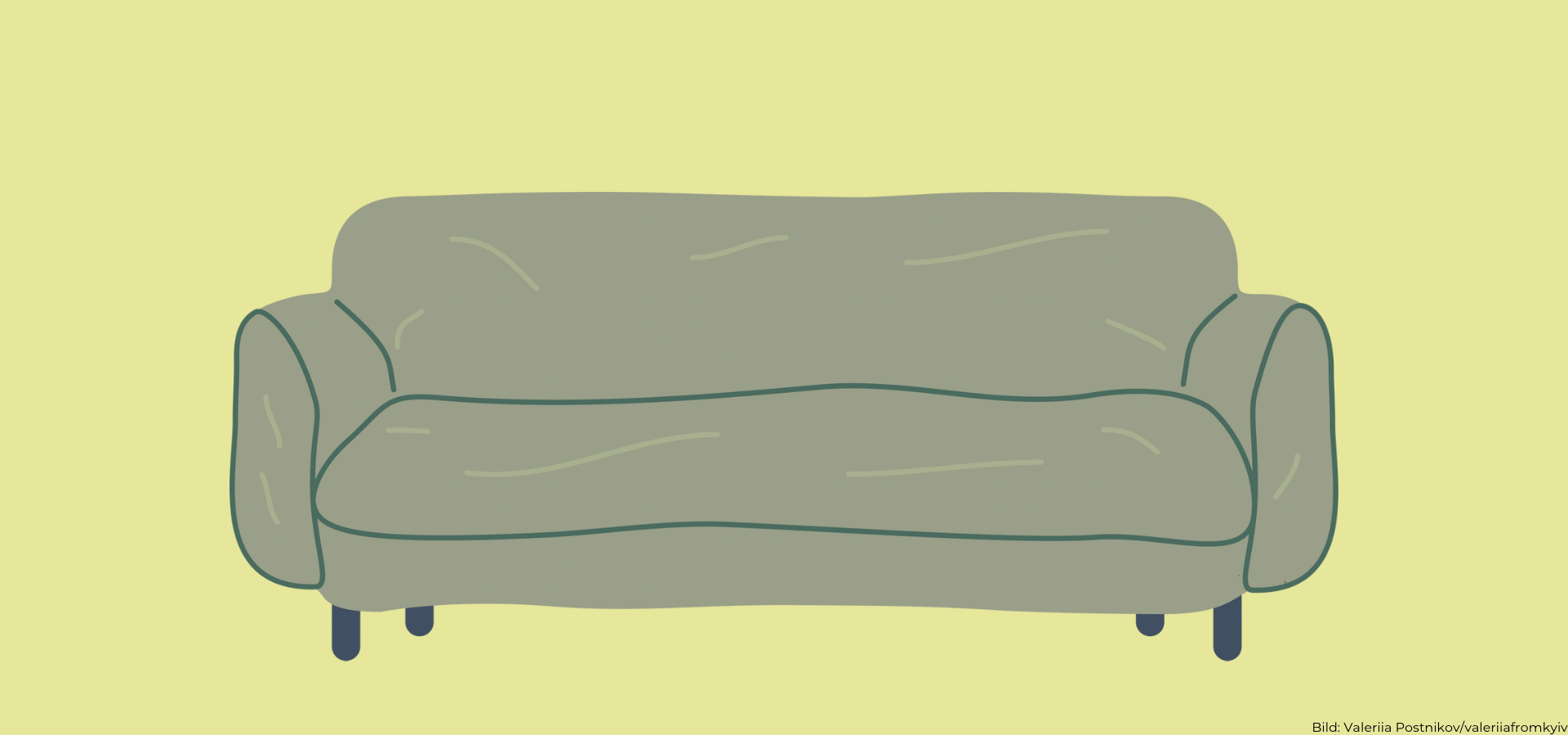
Für Antonia wird die Suche nach einem kassenfinanzierten Platz zur Geduldsprobe.
Den vielen Therapeut:innen, auf deren Sesseln und Sofas ich während meiner Suche saß, war schnell klar, dass eine Therapie mir helfen könnte. Allerdings hieß es nach einem Erstgespräch meist: „Keine Kapazität. Warteliste für kassenfinanzierte Plätze über sechs Monate.“ Psychotherapie zur Gänze aus meiner eigenen Tasche zu zahlen, kann ich mir schlichtweg nicht leisten. Als Studentin reicht das Geld dafür einfach nicht aus. „Wenn es ganz schlimm wird, gehen Sie in die Klinik. Kennen Sie schon diese App gegen Depressionen?“
Das erste Angebot für einen Therapieplatz erhielt ich im Universitätsklinikum bei einer Therapeutin in Ausbildung. In unserer zweiten Sitzung erzählte ich ihr von der Vergewaltigung einer Freundin. Nach kurzem Schweigen erwiderte Sie, was für manche eine schon Vergewaltigung sei, wäre für andere ganz normaler Sex. Ich brach die Therapie ab, bevor sie richtig begonnen hatte. Das zweite Therapieangebot bekam ich von einer Therapeutin kurz vor dem Ruhestand. Sie erkundigte sich nach der Nationalität eines Mannes, der mir gegenüber aggressiv geworden war, „um das Bild abzurunden“. Auf meinen Unmut hin räumte sie ein, dass die Nationalität eigentlich keine Rolle spiele, da Polen schließlich genauso aggressiv sein könnten, wie Syrer. Eine weitere Sitzung ersparte ich mir. Ich begann, mein Vorhaben der Therapie in Zweifel zu ziehen.
Mittlerweile hatte ich so viele Absagen kassiert, dass ich für das private Kostenerstattungsverfahren qualifiziert war. In diesem Verfahren übernimmt die Krankenkasse in Deutschland die Kosten für eine private Therapie, wenn kein Kassentherapieplatz in Sichtweite ist. Ich war frustriert. Mehr als frustriert. Zwar hatte ich inzwischen Kontakt mit einer Privattherapeutin, die mir einen Platz anbieten konnte, aber der Papierberg, der mit der Bürokratie des Kostenerstattungsverfahrens einhergeht, überforderte mich. Eine Freundin redete mir gut zu. Auch sie hatte ihren Therapieplatz über das Verfahren bekommen. Während ich auf dem Sofa weinte, sortierte meine Freundin die Formulare, die ich nun auszufüllen hatte. Telefonprotokolle. Tabellen mit Absagen von Therapeut:innen. Eine vorläufige Diagnose einer Therapeutin mit Kassensitz ohne Kapazität. Ein sogenannter Konsiliarbericht vom Hausarzt, der bestätigen soll, dass meine Leiden keine körperlichen Ursachen haben.
Mein Hausarzt schien trotz seinen geschätzten 60 Jahren Berufserfahrung Schwierigkeiten mit dem Konsiliarbericht zu haben. Er füllte das Formular fehlerhaft aus, woraufhin ich einen neuen Termin bei einer anderen Ärztin vereinbarte.
Auch sie tat sich mit dem Bericht schwer. Fast das gesamte Praxispersonal wurde zu Rate gezogen, sodass auch die anderen Patient:innen unfreiwillig über meinen Therapiebedarf informiert wurden. In der Ecke des Behandlungszimmers stand ihr etwa 14-jähriger Sohn, der betreten zu Boden schaute, als Sie sich detailliert nach meinen Missbrauchserfahrungen erkundigte. Es war „Boys-Day“ – ein Tag, an dem Kinder für einen Tag Einblick in ihren Traumberuf erhalten sollen. Ich wusste nicht, wer von uns beiden mir in dieser Situation mehr Leid tat.

60 Stunden Therapie wurden Antonia zugesichert. Was danach kommt, ist ungewiss.
Als ich den dicken Stapel Unterlagen schließlich in den Briefkasten meiner zukünftigen Therapeutin steckte, fühlte ich mich, als sei ich einen Marathon gelaufen. Aber ich entspannte mich. Die Therapeutin war mir sympathisch, mir gefiel ihre Praxis und die ganzen Mühen schienen nicht umsonst gewesen zu sein. Etwa eine Woche später klingelte mein Telefon. Die Therapeutin hatte festgestellt, dass wir beide in demselben Kulturprojekt arbeiteten und uns einen Freundeskreis teilten. Ich bot an, mich aus dem Projekt zurückzuziehen. Nach einiger Bedenkzeit sagte sie mir dennoch ab.
Auch wenn ich diese Entscheidung nachvollziehbar fand, war dies die Hiobsbotschaft, die dafür sorgte, dass ich meine Therapieplatzsuche erneut ernsthaft in Zweifel zog. All der Stress und die Rückschläge hatten mich zermürbt. Ich wusste nach wie vor, dass ich Hilfe brauchte. Aber der Weg dorthin hatte mir so zugesetzt, dass ich begann abzuwägen. Wie lange konnte ich noch weitermachen? War es die Mühen wirklich wert, wenn ich auch ohne Therapie „funktionsfähig“ war?
Tatsächlich meldete sich einige Zeit später eine Privattherapeutin bei mir, die ich vor Monaten um ein Erstgespräch gebeten hatte. Die E-Mail war durchgerutscht, aber sie wollte sich erkundigen, ob noch Bedarf bestehe. Meine proaktiven Bemühungen hatte ich zu diesem Zeitpunkt aufgegeben.
Mittlerweile bin ich bei dieser Therapeutin seit einigen Monaten in Therapie. Nachdem der erneute Kostenerstattungsantrag überwunden war, bewilligte die Krankenkasse 60 Therapiestunden. Die Bewilligung war zu keinem Zeitpunkt sicher. Meine Therapeutin erzählte, meine Krankenkasse tue sich mit der Erstattung üblicherweise schwer. Aktuell werden noch mehr Anträge zurückgewiesen als zu dem Zeitpunkt, an dem ich meinen gestellt hatte. Sollte ich nach 60 Stunden immer noch Bedarf haben, weiß ich nicht, ob ich bei meiner Therapeutin bleiben kann.
Ich weiß, dass Geschichten wie diese keinen Mut machen. Sie machen wütend. Mich zumindest. Allen Beteiligten war klar, dass ich Hilfe brauche. Der Krankenkasse, den Ärzt:innen, den Therapeut:innen, meinem Umfeld und auch mir. Und trotzdem hat es zwei Jahre gedauert, bis ich diese Hilfe bekommen habe. Es ist eine Sache, vom Mangel an Kassentherapieplätzen in den Nachrichten zu lesen. Eine andere, zu wissen, dass ich ohne die Unterstützung von Freund*innen und mit einer stärkeren Depression keine Chance auf einen Platz gehabt hätte. Meine Erfahrungen sind nur ein Beispiel von Vielen. Sie zeigen, dass wir Veränderung brauchen. Schnellstmöglich.
*Die Autorin möchte ihren Nachnamen in der Publikation des Textes nicht nennen. Der Redaktion ist ihre Identität bekannt.