Die Psychiatrie von morgen
Überfüllte Kliniken und Personalmangel bei zunehmenden Belastungen – durch die Eröffnung neuer Einrichtungen sollen die Probleme der Psychiatrie bald der Vergangenheit angehören.
Text: Nadja Riahi und Jana Reininger
Foto: Psychosoziale Dienste Wien/ZIMT Magazin/Canva AI

Antonia ist 16 Jahre alt, als sie in eine Kinder- und Jugendpsychiatrie kommt.
„Ich kann morgen nicht am Unterricht teilnehmen”, sagt Antonia. Draußen ist es schon dunkel, ihre Hand klammert sie um ihr Handy am Ohr. Morgen wird die 16-Jährige in die Psychiatrie gehen. Das hat ihr eben ihr Psychiater mitgeteilt. Keine Zeit zu warten, schließlich hat Antonia bereits mit suizidalen Gedanken Abschiedsbriefe geschrieben, die ihre Eltern dann in ihrem Zimmer gefunden haben. So hat eines zum anderen geführt und nun telefoniert Antonia spätabends ihre Lehrer:innen durch, um sie über ihre Abwesenheit zu informieren. Wie lange sie fehlen wird? Das weiß Antonia selbst nicht so genau.
Dieser Beitrag ist in bezahlter Kooperation mit den Psychosozialen Diensten Wien entstanden.
Rund 25 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Österreich sind psychisch schwer belastet, so Ewald Lochner, Koordinator für Psychiatrie, Sucht- und Drogenfragen der Stadt Wien – Tendenz steigend. Allein im Jahr 2022 wurden rund 25.000 Menschen in österreichischen Psychiatrien untergebracht, so Bernhard Rappert, Fachbereichsleiter der VertretungsNetz-Patient:innenanwaltschaft. Doch die Kliniken kämpfen mit einem schlechten Ruf: überfüllte Häuser und Personalmangel stehen an der Tagesordnung. Die Psychosozialen Dienste in Wien möchten das mit ambulanten Angeboten entschärfen. Junge Menschen sollen möglichst früh behandelt werden, auch um den stationären Bereich zu entlasten.
Eine lange Krankheitsgeschichte
Bereits als kleines Kind hat Antonia große Ängste: Dass ihr Haus zu brennen beginnt, dass jemand bei ihr im Zimmer steht, dass fremde Männer sie entführen wollen. Diese Ängste sind zuhause nichts Neues. Auch Mama hat sie. Wenn Papa nachts weg ist, holt sie Antonia und ihren Bruder zu sich ins Bett und sperrt die Schlafzimmertür zu – aus Sorge, jemand könnte die Familie umbringen. Dadurch fühlt Antonia sich in ihren Sorgen bestätigt. Wenn auch die erwachsene Vertrauensperson sich fürchtet, wird die Angst wohl begründet sein.

Am Abend vor ihrem Psychiatrieaufenthalt ruft Antonia all ihre Lehrer:innen an, um sich von der Schule abzumelden.
Als Antonia elf Jahre alt ist, hat sie große Schulangst. Sie entwickelt Zwänge, spannt ihren Hals an, bis sie heiser wird. Sie beginnt, Stimmen zu hören und Menschen zu sehen, die eigentlich gar nicht da sind: Manchmal sprechen in ihrem Zimmer ihre Lehrer:innen zu ihr, manchmal laufen neben dem fahrenden Auto fremde Menschen her. Das Mädchen merkt selbst, dass etwas nicht stimmt und beginnt schon bald zu einer Kinderpsychologin zu gehen. Die Behandlung tut ihr gut, aber als sie 14, vielleicht 15 Jahre alt ist, kommen zu ihren Sorgen auch Depressionen hinzu. „Da ist viel zusammengekommen”, erinnert sich Antonia, die im Gespräch mit ZIMT ruhig auf ihrem Sessel sitzt. „Hardcore-Pubertät und ich hab mir in der Oberstufe schwer mit neuen Leuten getan.”
Der Schülerin fällt es schwer, Routinen beizubehalten, morgens aufzustehen und sich anzuziehen. Immer wieder beschäftigen sie Gedanken an den Tod. Als die Corona-Pandemie einzieht, ist Antonia 16 Jahre alt. Die Schule wird ins Homeschooling verlegt und die Jugendliche sieht ihre Freund:innen nur noch auf dem Bildschirm. „In mir drin war schon immer dieses Gefühl der Hoffnungslosigkeit und dann kam auch noch diese wirklich hoffnungslose Situation.” Die Abschiedsbriefe, die Antonia eines Tages schreibt, finden ihre Eltern. Es dauert nicht lange, bis ihr Psychiater dem Mädchen einen Platz in der Psychiatrie verschafft – ein großes Glück, das keine Minute zu früh kommt, wie Antonia findet, denn vielen Menschen in psychischer Not bleibt diese Chance verwehrt.
Überfüllte Psychiatrien weisen Patient:innen ab
Von überfüllten Psychiatrien wird besonders seit der Zeit der Pandemie berichtet. 2021 schlägt das Wiener Allgemeine Krankenhaus (AKH) Alarm: Es habe keine Ressourcen mehr, um den erhöhten Bedarf mental erkrankter Kinder und Jugendlicher gerecht zu werden. Eine steigende Zahl von Depressionen und Essstörungen verschärfen die Krise. Auch dem ZIMT Magazin liegen Berichte von jungen Menschen vor, die wegen Platzmangel von psychiatrischen Einrichtungen abgewiesen wurden. Eine klinische Psychologin erzählt von einer Patientin, die bereits einen Suizidversuch hinter sich hatte, aber erst nach vermehrten Anrufen der Psychologin aufgenommen werden konnte.

In Zimmern, die eigentlich für zwei Patient:innen gedacht sind, übernachtet Antonia nun mit drei weiteren Jugendlichen.
Antonia hat mehr Glück. Als sie sich bei der Ankunft in der Psychiatrie von ihren Eltern verabschiedet, wirken diese aufgelöst. Antonia ist still. Ihre Depressionen machen sie leer, der Abschied berührt sie nicht. In der Psychiatrie angekommen, werden der Schülerin die Schnürsenkel abgenommen, „wie man das aus den Filmen kennt”. Ihre erste Nacht in der Psychiatrie muss Antonia auf der Intensivstation verbringen, Überwachungskameras auf sie gerichtet. Am nächsten Tag zieht die 16-Jährige auf die reguläre Station um. In Zimmern, die eigentlich für zwei Patient:innen gedacht waren, übernachten sie nun zu viert.
5.923 Betten gibt es laut Gesundheitsministerium aktuell in österreichischen Psychiatrien – und das für Erwachsene und Jugendliche gemeinsam. Gleichzeitig leben laut Statistik Austria 1,76 Millionen Kinder und Jugendliche in Österreich. Ist ein Viertel davon schwer belastet, kommt man folglich auf rund 440.000 junge Menschen, von denen nur ein Bruchteil Chance auf einen Platz hat. Doch mit den Betten endet das Problem nicht.
Ungeschulte Pfleger:innen verschlimmern die Situation
„Wir haben viel zu wenige Pfleger:innen”, erzählt Wolfgang, der selbst seit fast 40 Jahren als Pfleger in einer Wiener Psychiatrie arbeitet. Das führe dazu, dass nicht nur viele Betten, sondern auch ganze Stationen gesperrt werden – so auch jene Station, in der er selbst bis vor kurzem gearbeitet habe. „Momentan arbeite ich dort, wo ich gebraucht werde”, schildert er. Eigentlich sollte seine Station Anfang November wieder aufsperren, aber dafür fehlt das Personal. Die Folge davon sei, dass andere Abteilungen Patient:innen aus der Psychiatrie aufnehmen müssen. Die Pfleger:innen dort seien jedoch nicht für den Umgang mit psychisch erkrankten Personen geschult und würden sie folglich oft falsch behandeln.

„Einige Mitarbeiter:innen machen einen echt tollen Job”, erzählt Antonia im Gespräch mit ZIMT – etwa jene, die pferdegestützte Therapie anbieten, jene, die mit den Jugendlichen spazieren gehen oder jene, die am Wochenende Tomaten aus dem eigenen Garten mitbringen, damit die Patient:innen gemeinsam Sugo einkochen können. Oder jene pensionierten Lehrer:innen, die ehrenamtlich in der Schule unterrichten, die sich in der Klinik befindet. „Da hat es sich nicht angefühlt, als wäre man in einer Psychiatrie. Du warst dort nicht die Antonia mit Depressionen, sondern du warst einfach dort und hast jetzt Mathe gemacht mit diesem süßen, alten Professor. Das war schön.”
Aber es gibt eben auch die anderen Mitarbeiter:innen – die, die ihre Launen an den Patient:innen auslassen, sie anschreien, wenn sie sich nicht aus dem Bett bewegen wollen, sie beschimpfen, wenn sie beim abendlichen Fernsehen mit den anderen Jugendlichen im Gemeinschaftsraum zu laut lachen oder ihnen nahelegen, dass sie ihnen ihre Symptome nicht glauben. „Gerade als junges Mädchen sucht man da schnell die Schuld bei sich selbst”, so Antonia – und das in einer Situation, in der man ohnehin schon mit suizidalen Gedanken kämpft. Zu körperlichen Maßnahmen kommt es bei Antonia jedoch nicht.
Was dem Mädchen erspart bleibt, müssen andere Patient:innen über sich ergehen lassen. Davon berichtet auch Wolfgang. Fixierungen sollen Menschen in psychotischen Zuständen in erster Linie davor schützen, sich selbst oder andere zu gefährden. Doch gegen seinen Willen an ein Bett gebunden zu werden, löst Angst und nicht selten Traumatisierungen aus, so der Pfleger. Auch wenn diese mit Nachbesprechungen zu minimieren versucht wird.
Die Psychiatrie der Zukunft soll ambulant werden
Geht es nach Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker, gehören Fixierbetten ohnehin bald der Vergangenheit an. Er sieht die Zukunft der Psychiatrie in Tagesambulatorien, in denen Patient:innen gar nicht mehr übernachten sollen, und diesen Trend erkennt Dr. Georg Psota, Chefarzt der Psychosozialen Dienste in Wien, auch in anderen Bereichen der Medizin. Stationäre Aufenthalte sollten möglichst gering und zu kurz wie möglich, aber auch so lange wie notwendig sein.

Fixierungen und Videüberwachungen gibt es in den Einrichtungen der Psychosozialen Dienste in Wien nicht, erklärt Chefarzt Dr. Georg Psota.
Bis 2029 sollen in Wien insgesamt sechs kinder- und jugendpsychiatrische Ambulatorien stehen. Das dritte dieser Art wurde soeben in der Lasallestraße im zweiten Wiener Gemeindebezirk eröffnet. 600 bis 800 Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen Alter sollen hier jährlich auf den Weg der Besserung gelangen. Fixierungen und Videoüberwachungen werde es hier keine geben, sagt Dr. Psota entschlossen. Wie wird dann sichergestellt, dass sich junge Menschen in psychotischen Zuständen nicht selbst gefährden?
Während der Eröffnung des Hauses steht das neu aufgestellte Team eng beisammen. Die jungen Frauen und Männer flüstern und lachen. In den Wochen zuvor seien viele Ressourcen aufgebracht worden, um gemeinsam Strategien zu erarbeiten, mit denen das Wohlergehen der Patient:innen sichergestellt werden könne, erklärt Kinder- und Jugendpsychiaterin Dr.in Doris Koubek, die ärztliche Leiterin des Ambulatoriums. Das multiprofessionelle Team besteht aus vielen unterschiedlichen Berufsgruppen: aus Ärzt:innen und Pfleger:innen, aus klinischen Psycholog:innen und Ergotherapeut:innen, Physiotherapeut:innen, Diätolog:innen, Musiktherapeut:innen, Sozialpädagog:innen, Sozialarbeiter:innen und Verwaltungsassistent:innen. Schwerpunkt in der zur Einrichtung gehörenden Tagesklinik liegt auf der Behandlung junger Menschen mit Essstörungen.
Doch natürlich könne es passieren, dass Patient:innen in stationäre Einrichtungen überwiesen werden, wenn die Schwere der Erkrankung dies erfordert, sagt Psota. Der Ausbau ambulanter Angebote soll den stationären Bereich auch gar nicht ersetzen. Für fremd- und selbstgefährdende Menschen wäre eine abendliche Entlassung fahrlässig. Vielmehr soll der ambulante Ausbau den stationären entlasten, die Patient:innen bedürfnisorientiert besser aufteilen und damit auch Druck von überfüllten Stationen und Mitarbeiter:innen nehmen, die in Stresssituationen unpassend handeln.

Dr.in Doris Koubek (ganz links), ärztliche Leiterin des neuen Ambulatoriums und Ewald Lochner (ganz rechts), Koordinator für Psychiatrie, Sucht- und Drogenfragen der Stadt Wien, führen ihren Besuch durch die Räume des neuen Ambulatoriums.
Damit das passieren kann, müsse aber auch der stationäre Bereich erweitert werden, etwa mit erhöhten Ausbildungsstellen für Fachärzt:innen der Kinder- und Jugendpsychiatrie, wie Stadtrat Hacker betont – oder mit einer Ausbildung, die sensibel auf die Anforderungen der Psychiatrie abgestimmt ist, statt auf den medizinischen Bereich allgemein, wie Wolfgang findet. Auf Nachfrage von ZIMT werden seitens des Gesundheitsministeriums derzeit jedoch keine geplanten Maßnahmen genannt.
Zurück in den Alltag
Einige Wochen ist Antonia im psychiatrischen Krankenhaus, als sie den Moment erlebt, den sie heute als ihren Durchbruch bezeichnet. In der Musiktherapie darf sich die 16-Jährige ein Instrument aussuchen, sie wählt die Kalimba, ein kleines Instrument aus Holz und Metall, das sie mit den Daumen bedient und Antonia an eine Spieluhr für Kinder erinnert. Als die Therapeutin Antonia bittet, ihrem jüngeren Ich etwas vorzuspielen, fängt sie plötzlich an, unkontrolliert zu weinen und kann damit für eine lange Weile überhaupt nicht mehr aufhören.
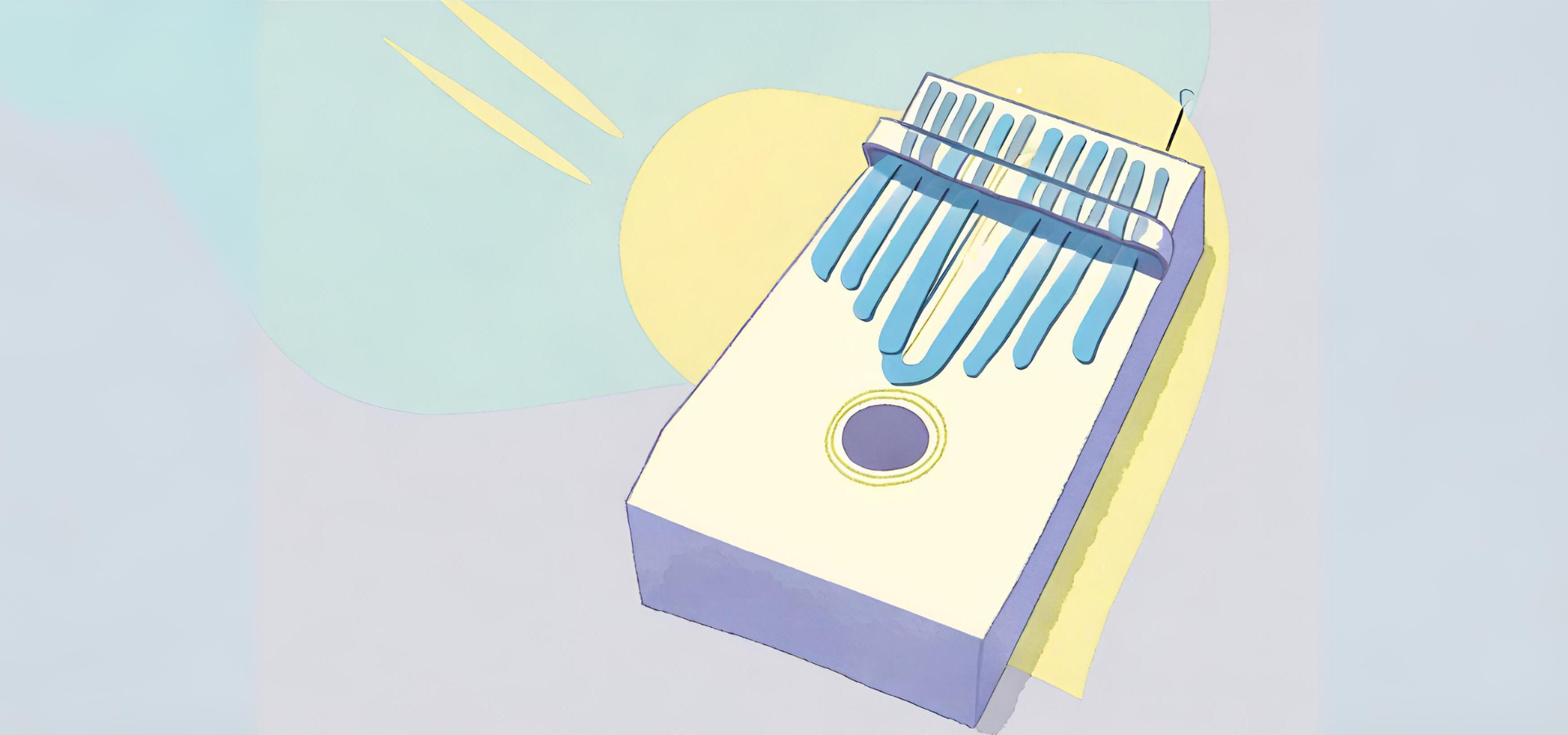
Ihren therapeutischen Durchbruch erlebt Antonia, als sie in der Musiktherapie auf der Kalimba spielt.
„Ich habe in der Psychiatrie das erste Mal richtig an meiner Kindheit gearbeitet”, erzählt die heute 19-Jährige. „Das war richtig krass. Ich hab’s gar nicht gepackt, aber es war schön. Es war wirklich schön, weil ich das Gefühl hatte, dass irgendetwas in mir aufgegangen ist.”
Als Antonia die Psychiatrie hinter sich lässt, beschäftigt sie der Gedanke, zurück in ihrer Klasse auf unangenehme Fragen zu stoßen. „Ich mag es nicht, verletzlich zu wirken”, sagt sie. „Und es gibt nichts Verletzlicheres als das.” Während ihrer Abwesenheit hat sich der Unterricht in ihrer regulären Schule aus dem Homeschooling wieder vor Ort verlegt. Antonia ist nervös, als sie den Klassenraum betritt – und wenige Minuten darauf erleichtert. Statt unerwünschten Fragen steht auf einem der Tische ein Kuchen für sie. „Weil ich zurückgekommen bin, haben die anderen für mich gebacken. Das war schon echt süß.”