Keine Psychotherapie ohne Geld?
Wer sich Therapie nicht selbst leisten kann, kann sich auch nicht seine:n Therapeut:in aussuchen. Das beeinflusst den Erfolg der Behandlung.
Text: Isabella Wagner
Illustrationen: Ruth Gafko

Mary sitzt im Bus, vor dem Fenster rauschen die Straßen an ihr vorbei. Doch ihre Gedanken sind woanders. Die damals 18-Jährige leidet an einer Essstörung. Ihre Eltern haben nicht viel Geld, wollen ihrem Kind aber unbedingt eine Therapie ermöglichen. Lange Zeit hat Mary nach einem leistbaren Therapieplatz gesucht. Nach mehreren Anläufen hat die Tirolerin nun einen gefunden, für den sie kaum zahlen muss, weil er von einer sozialen Einrichtung finanziert wird. Doch Mary fühlt sich mit ihrer Therapeutin nicht wohl. Sie empfindet sie als kühl und tut sich schwer, sich ihr gegenüber zu öffnen. Wenn sie von ihren Sorgen erzählt, fühlt sich Mary nicht verstanden. Immer wieder hat sie den Eindruck, ihre Gefühle erklären zu müssen. Aber ob Mary so schnell einen anderen leistbaren Therapieplatz finden kann? Die Schülerin ist ratlos.
So wie Mary, die eigentlich anders heißt, aber ihren wahren Namen nicht offenlegen möchte, geht es vielen Menschen, die wenig Einkommen haben. Einer Studie von Friedrich Riffer und seinen Co-Autor:innen zufolge, haben in Österreich nur rund 30 Prozent der Menschen, die eine psychische Erkrankung haben, einen kassenfinanzierten Psychotherapieplatz. Der Berufsverband österreichischer Psycholog:innen (BÖP) ergänzt: Für 65 Prozent der österreichischen Bevölkerung wäre Psychotherapie nicht leistbar, sollten sie sie einmal brauchen. Die Suche nach einem kostengünstigen und langfristigen Therapieplatz ist langwierig und kostet Kraft. Diese fehlt meistens, wenn man mit psychischen Belastungen zu kämpfen hat. Wer letztlich einen leistbaren Therapieplatz gefunden hat, muss oft auf eines verzichten: die freie Wahl einer:s passenden Therapeut:in. Das ist ein Problem, denn wo die Beziehung zwischen Klient:innen und ihrem Gegenüber nicht zusammenpassen, hat Therapie meist keinen Erfolg.
Auch für Mary, die heute 21 Jahre alt ist, ist die Suche nach einem kostenlosen Therapieplatz lange und kompliziert. Die erste Therapie, die sie in Anspruch nimmt, kostet 60 Euro pro Stunde – wenig, im Vergleich zu den meisten Therapieangeboten. Dennoch bedeutet das hohe Kosten für Marys Eltern. Immer wieder hat die Tochter deshalb ein schlechtes Gewissen. Eigentlich, so findet Mary, würden ihre Eltern das Geld doch selbst für Therapie brauchen. Sie tut sich schwer, sich auf die Therapie einzulassen, die Gespräche mit der Therapeutin helfen ihr nicht. Mary bricht die Therapie ab, die Kosten sind einfach zu hoch. Mary bleibt mit einem Schuldgefühl und der Angst, niemals eine passende Therapeutin zu finden, zurück. Trotzdem bessert sich ihre Symptomatik eine Zeit lang.

Psychotherapie leert den Geldbeutel von Armut betroffener Menschen zusätzlich – und kann deshalb oft nicht (dauerhaft) in Anspruch genommen werden.
Ein paar Jahre später geht es Mary wieder schlechter. Die Tirolerin probiert es bei einer sozialen Einrichtung, die ihr ein paar Stunden zu günstigen Tarifen anbietet. Sie führt ein Beratungsgespräch mit einer Therapeutin, die gestresst und unfreundlich wirkt. Die darauffolgende Wartezeit auf einen Therapieplatz in der Einrichtung beträgt sechs bis acht Monate. Doch Mary braucht dringend Hilfe. Sie sucht weiter. Im dritten Anlauf findet sie schließlich einen unbefristeten Therapieplatz, der nichts kostet. Mary ist erleichtert, endlich eine Therapie gefunden zu haben, die – den geringen Selbstbehalt von fünf Euro ausgenommen – mit keinen weiteren Kosten für sie verbunden ist, fühlt sich aber mit der Therapeutin nicht wohl. Die Therapeutin erscheint der damals 18-Jährigen sehr kühl, sie tut sich schwer Vertrauen zu ihr zu fassen. Immer wieder hat sie das Gefühl, die Frau verstehe ihre Sorgen nicht. Die Fragen, die sie stellt, erscheinen Mary nicht passend. Tipps und Hilfestellungen gehen an Marys Alltag vorbei. Die Therapeutin scheint kein Wissen über das Leben mit wenig Geld zu haben. Aus Angst hat, keinen anderen kostenlosen Platz zu finden, führt sie die Therapie fort. Hilfreich ist sie ihr jedoch nur bedingt.
Ausgrenzungsfeld Psychotherapie
Psychotherapie stellt keine reguläre Kassenleistung dar. Das ist ein Problem, denn bei einem durchschnittlichen Stundensatz von 90 Euro kommen für Patient:innen monatlich um die 360 Euro zusammen, erklärt die Psychologin und Soziologin Johanna Muckenhuber, die an der FH Joanneum in Graz im Fach Soziale Arbeit lehrt und sich mit sozialer Ausgrenzung in der Psychotherapie beschäftigt. Diesen Betrag müsse man sich erst einmal leisten können, so die Psychologin und Soziologin. Zwar leistet die Gesundheitskasse für die privat finanzierten Stunden einen je nach Bundesland variierenden Zuschuss zwischen 29 und 40 Euro, wie der Österreichische Bundesverband für Psychotherapie (ÖBVP) angibt, dennoch fallen dabei im Schnitt immer noch hohe monatliche Kosten an.
Von der Krankenkasse finanzierte Therapieplätze, für die man nur einen geringen Selbstbehalt zahlen muss, sind längst nicht in der Zahl vorhanden, in der sie gebraucht werden. 80 Prozent der in Österreich in Anspruch genommenen Therapiestunden werden privat finanziert. Laut dem ÖBVP hat nur rund 1 Prozent der Bevölkerung in Österreich einen komplett krankenkassenfinanzierten Therapieplatz. In psychosozialen Beratungsstellen und in Universitätsambulanzen, wo Therapeut:innen in Ausbildung unter Supervision arbeiten, gibt es kostengünstigere oder teilweise kostenlose Therapieangebote, diese sind jedoch äußerst gefragt und vor allem in ländlichen Gegenden wenig vorhanden. Meist gibt es Wartelisten, bei denen man länger auf einen Platz wartet. Hinzu kommt, dass in Beratungsstellen oft nur eine begrenzte Anzahl an Stunden angeboten werden kann. Eine langfristige und wirkungsvolle Therapie ist damit nur schwer möglich.
Die Folge ist, dass besonders Menschen, die in Armut leben und mit wenig Einkommen auskommen müssen, zu großen Teilen von der therapeutischen Versorgung abgeschnitten sind – das ist eine Form von strukturellem Klassismus, also der Benachteiligung von Menschen, mit wenig Einkommen und wenig formaler Bildung, die über gesellschaftliche Einrichtungen, wie beispielsweise Arzt- und Therapiepraxen, ausgetragen wird. So beschreibt es die deutsche Kulturanthropolog*in Francis Seeck.
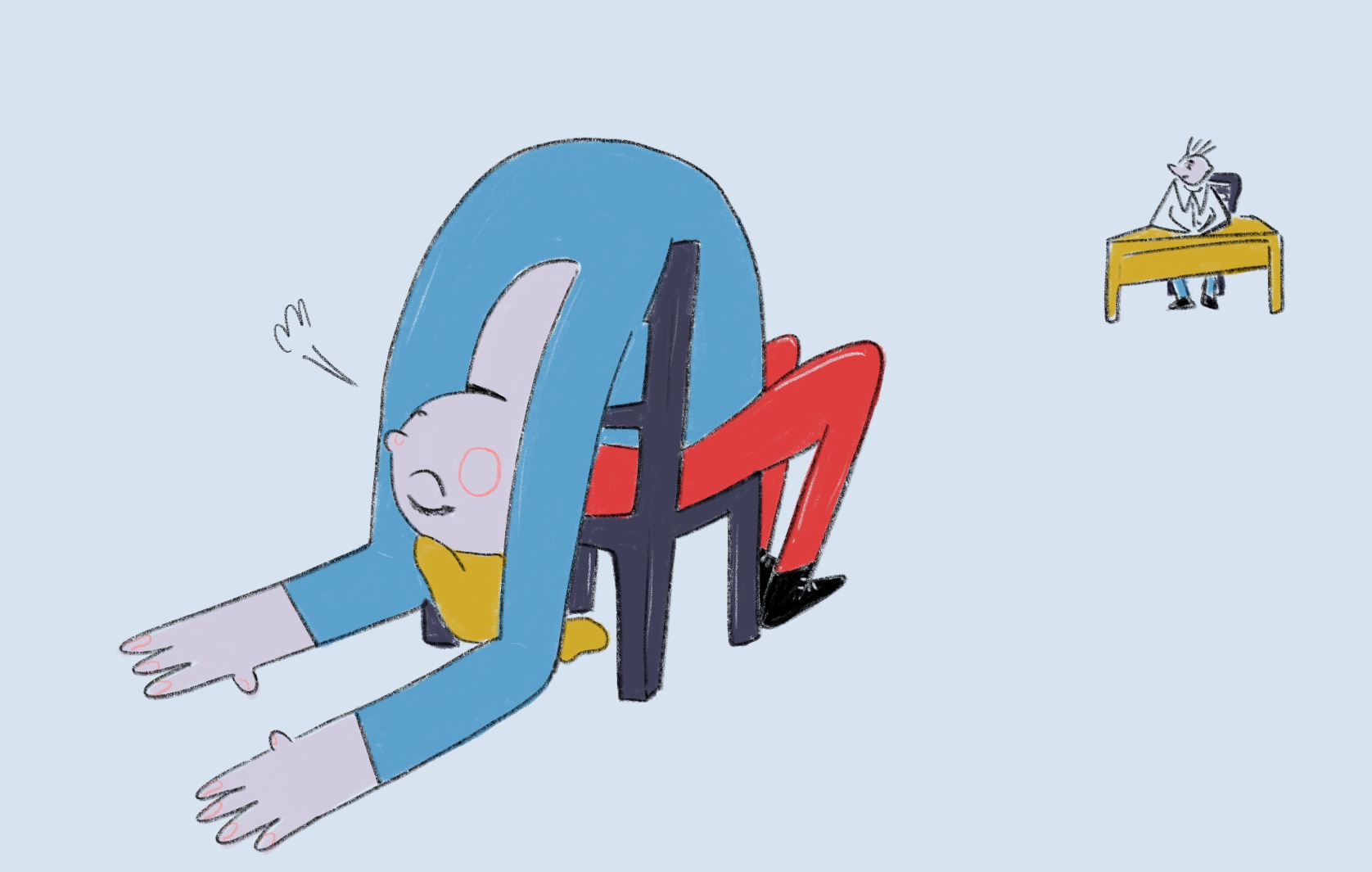
Von Klassismus betroffen, so eine Studie der Europäischen Union, sind in Österreich vor allem Alleinerzieher:innen und ihre Kinder, Obdachlose, Langzeitarbeitslose und Menschen ohne österreichische Staatsbürgerschaft. Aber auch Menschen, die Teilzeit oder Vollzeit arbeiten und dennoch zu wenig Geld verdienen, um sich wesentliche Dinge im Leben leisten zu können, können aufgrund ihrer Herkunft Ausgrenzung erfahren. In ungleichen Gesellschaften, wie der österreichischen, so die Soziologin Barbara Rothmüller, werden der Zugang zu Geld, Bildung oder Gesundheit vor allem dadurch bestimmt, ob man in eine Familie mit viel, wenig oder keinem Vermögen und Einkommen hineingeboren wird. Auch psychische Gesundheit werde damit zu einer Frage der Herkunft.
Klassismus macht krank
Besonders problematisch ist diese Ausgrenzung, weil gerade Menschen, die von Armut und Klassismus betroffen sind, häufiger unter physischen und psychischen Erkrankungen leiden als Menschen, die ein gesichertes Einkommen haben. Sie haben ein erhöhtes Risiko für Herzinfarkte, Schlaganfälle, Diabetes und verschiedene Tumorerkrankungen, so eine Studie des deutschen Robert-Koch-Institutes. Ihr allgemeiner Gesundheitszustand ist häufig schlechter, ebenso wie ihre gesundheitsbezogene Lebensqualität. Das gilt auch für Österreich. Die Statistik Austria weist für die österreichische Bevölkerung unter der Armutsgrenze – das sind im Jahr 2021 1.519.000 Menschen, also 17 Prozent der Bevölkerung – einen dreimal schlechteren Gesundheitszustand auf als für Personen mit hohem Einkommen, wie Beatrice Frasl eine Studie der Statistik Austria zitiert. Ein „geringes Einkommen, geringe formale Bildung, sowie Armut und Armutsgefährdung […]“ gelten laut dem österreichischen Gesundheitsministerium als wesentliche Risikofaktoren für Depression und Suizidalität.
Auch an der Lebenserwartung zeigen sich die finanziellen Unterschiede: Von Armut oder Ausgrenzung aufgrund des sozialen Status betroffene Menschen sterben im Schnitt 10 Jahre früher als Menschen mit einem höheren sozialen Status, so Francis Seeck.
Larissa, die eigentlich anders heißt, aber nicht mit ihrem richtigen Namen in Erscheinung treten will, ist heute 27 Jahre alt. Sie ist in einer ländlichen Gegend im Mühlviertel, wo es wenig Infrastruktur gibt, gemeinsam mit ihrer Mutter und ihren beiden Brüdern aufgewachsen. Larissas Eltern sind getrennt, sie lebt mit ihren Geschwistern bei ihrer alleinerziehenden Mutter. Ihre Mutter hat keine formale Ausbildung und hält sich und die Kinder mit Teilzeit- und Gelegenheitsjobs über Wasser. Meistens reicht es gerade für das Nötigste. Essen ist immer im Kühlschrank, aber wenn das Auto oder die Waschmaschine kaputt gehen, ist die Verzweiflung groß. Larissa bekommt schon früh mit, wie sehr ihre Mutter mit finanziellen Sorgen und Ängsten zu kämpfen hat. Nicht selten bricht die Mutter vor ihr in Tränen aus.
Larissa fühlt sich hilflos und weiß nicht, wie sie sich verhalten soll. Während sie ein paar Jahre zuvor noch ein sehr aktives Kind war, das gerne den ganzen Tag draußen verbracht hat, zieht sie sich zunehmend zurück und versucht, keine zusätzliche Belastung für ihre Mutter zu sein. Den Stress schluckt sie runter und versucht allein mit ihren Sorgen und Ängsten klarzukommen. Weder für Larissas psychische Gesundheit noch für die ihrer Mutter oder ihrer Brüder ist in dieser Situation Platz. Existenzielle Fragen, wie ob man die Wohnung halten und sie beheizen kann und wie man zur Arbeit kommen soll, wenn das Auto kaputt ist und das Geld für die Reparatur fehlt, geben überhaupt gar nicht erst den Raum, sich mit psychischer Gesundheit auseinanderzusetzen.
Psychisches Wohlbefinden wirke oftmals wie ein Luxusgut, erklärt die Psychologin Paula Kittelmann, die in einer psychosomatischen Reha-Einrichtung in Deutschland arbeitet.
„Armutsbetroffenen Menschen geht es oft um ganz andere Dinge wie, dass man die Heizung abdrehen muss, um Geld zu sparen oder darum, wie man sich die Woche das Essen leisten kann.“
Die Armut stellt die Betroffenen vor so viele existenzielle Fragen, dass für die Auseinandersetzung mit dem eigenen Wohlbefinden und der Psyche weder Zeit noch Raum ist.
Armut als Trauma
Armut, so Kittelmann, ähnele in wesentlichen Punkten einer Traumatisierung. Der Verlust von Sicherheit und von Kontrolle über das eigene Leben sowie das hohe Stresserleben und Gefühle von Ohnmacht und Hilflosigkeit angesichts existentieller Bedrohungen beschreiben auch Aspekte von traumabezogenen Diagnosen, wie einer Posttraumatischen Belastungsstörung. Armut sei purer Stress und das nicht nur für zeitlich begrenzte Episoden, sondern permanent. Die Sorge davor, die Wohnung zu verlieren oder nicht ausreichend Essen am Tisch zu haben, versetzt den Organismus in eine permanente Stressreaktion, aus der es ohne eine Besserung der Lebensumstände oder Hilfe von außen sehr schwer ist, wieder herauszukommen. Dauert die Armut länger an, setzt in den meisten Fällen eine Resignation ein, die ein Ausbrechen aus der Armutsspirale zusätzlich erschwert. Der Kreislauf aus Armut und psychischer Erkrankung setzt sich fort.
Das erlebt auch Larissa. Neben den ständigen Sorgen der Eltern und dem Stress, den sie dadurch erlebt, wird sie depressiv. Nach der Schule unternimmt Larissa nicht wie andere Kinder etwas mit Freunden, sondern zieht sich in ihrem Zimmer zurück und schaut fern. Ganze Nachmittage verbringt sie vor dem Gerät. Dinge für ihre psychische Gesundheit zu tun, schafft sie schlichtweg nicht.
Die Armut an sich gilt für viele Menschen als Stigma, das sie im Kontakt mit Therapeut:innen nur ungern offenbaren, erklärt Paula Kittelmann. Armutsbetroffene Menschen haben die Abwertung, die sie von außen erfahren, oftmals verinnerlicht und schämen sich für ihre Situation, so die Psychologin. Sie glauben, sie wären selbst schuld an ihrer Situation und ziehen sich infolgedessen zurück. In dieser Situation sei es wichtig, dass Therapeut:innen sensibel mit der schwierigen Lage ihrer Klient:innen umgehen, um keine weitere Beschämung zu erzeugen, betont auch Muckenhuber. Auch reden Ärzt:innen, so erzählt die Psychologin, oft länger mit Menschen, die denselben Bildungsstand wie sie aufweisen. Wie nahe man sich ist, ob man eine gemeinsame Sprache spricht und geteilte Erfahrungen hat, wird damit oft zu einer Voraussetzung von Psychotherapie, in der es nicht zu subtilem Klassismus komme, so Muckenhuber.
Doch in vielen Fällen stammen Psychotherapeut:innen selbst aus eher einkommensstarken Familien – schließlich kostet die Ausbildung zur Psychotherapeutin je nach Therapierichtung und Dauer der Ausbildung zwischen 25.000 und 50.000 Euro, wie aus den Angaben der Ausbildungsstätten zu entnehmen ist. Das gliedert Menschen, die den Alltag mit weniger Geld selbst kennen, in vielen Fällen aus. Zwar sparen sich immer wieder auch einkommensschwache Therapeut:innen das Geld für die Ausbildung mühsam zusammen, dennoch wäre es wichtig, einer breiteren einkommensschwachen Schicht den Zugang zur Ausbildung zu ermöglichen. Nur so können Therapeut:innen, die selbst Armutserfahrungen gemacht haben, mit jener Klient:innengruppe arbeiten, deren Gefühle sie aus erster Hand nachvollziehen können, findet die Psychologin Kittelmann.
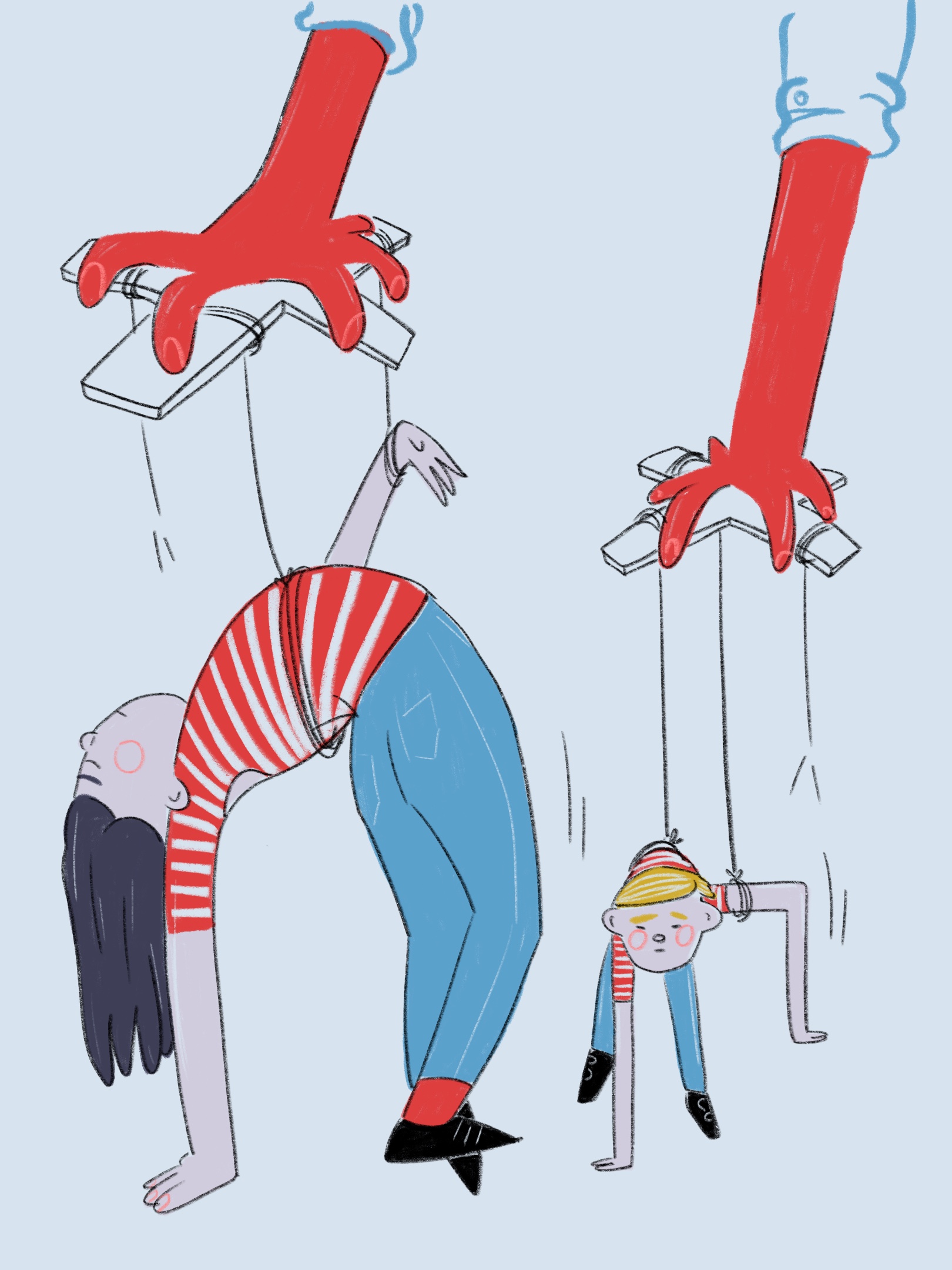
Doch nicht nur Armut ist stigmatisiert, auch psychische Erkrankungen an sich stellen ein Stigma dar. Neben ihrer Vollzeitarbeit im Supermarkt fällt es Mary schwer, jene Termine mit ihrer Therapeut:in und ihrer Sozialarbeiter:in wahrzunehmen, die sie zwei Mal pro Woche besuchen soll. Immer wieder muss sie Termine verschieben oder in der Arbeit um Freistellung ansuchen, um zu ihrer Therapeutin gehen zu können. Weil das Thema psychische Gesundheit unter ihren Kolleg:innen und beim Chef Tabu ist und die Kolleg:innen auf Mary auch sehr belastet wirken, traut sie sich nicht, offen über ihre gesundheitlichen Anliegen zu sprechen. Als ihre Therapeut:innen Mary einen stationären Aufenthalt vorschlagen, lehnt sie ab. Sie fürchtet, von ihren Kolleg:innen ausgegrenzt zu werden. In der Arbeit erzählt sie vor jedem Termin, für den sie um Freistellung ansucht, dass sie zu einem jener Fachärzte geht, deren Besuch gesellschaftlich akzeptiert ist, obwohl die Kolleg:innen und der Chef misstrauisch auf die vielen Termine reagieren.
Angst vor Bestrafung
Die Furcht, die das Stigma rund um Therapie bei Mary auslöst, ist für Menschen, die Leistungen vom Staat beziehen, und sich somit in einem Abhängigkeitsverhältnis zu Behörden empfinden, oft umso höher. Zu Therapeut:innen zu gehen, kann mit einem Gang zur Behörde assoziiert werden, erklärt Kittelmann. Dabei ist die Sorge um Sanktionen groß – so fürchten etwa manche Eltern, dass ihnen bei psychischer Instabilität die Kinder entnommen werden oder Arbeitslose, dass ihnen Geld gestrichen würde. Während laut Beatrice Frasl vor allem Angehörige höher qualifizierter, innerstädtischer Milieus kein Problem haben, offen über ihre psychische Gesundheit zu sprechen, gelten psychische Erkrankungen in der Arbeiter:innenklasse und bei von Armut betroffenen Menschen oftmals als Defizit, mit dem man nicht in Verbindung gebracht werden möchte. Das sorgt für Unwissen über Leistungen, Angebote und Wirkungsweisen von Psychotherapie. Vor allem Arbeiter:innen und armutsbetroffene Menschen sehen Psychotherapie oftmals gar nicht als Option für sich und wissen nicht, wie sie ihnen helfen kann, meint die Psychologin Muckenhuber.
Damit sich diese Wahrnehmung ändert, braucht es eine klare Trennung zwischen privater Psychotherapie und sozialarbeiterischer Begleitung durch Ämter und Behörden, wie Olivier David, ein Autor, der selbst in Armut aufgewachsen ist, im Vorfeld der Recherche erzählt. Es muss klar sein, dass Therapeut:innen genau wie Ärzt:innen, zur Verschwiegenheit verpflichtet sind und keine Informationen an Ämter und Behörden weitergeben dürfen. Doch Armutsbetroffenheit, Klassismus und deren Relevanz für die psychische Gesundheit würden im psychologischen Feld noch nicht in jenem Ausmaß reflektiert, in dem es notwendig wäre, so die Soziologin Barbara Rothmüller. Eine Reflektion der Effekte und Wirkung von Armut und Diskriminierung auf die Psyche hält sie für sehr wichtig, um eine angemessene Versorgung von armuts- und klassismusbetroffenen Menschen sicherzustellen. Doch wie kann das gelingen?
Ausbau von Psychotherapie dringend benötigt
Zwar hat die Psychotherapie nicht den Anspruch, die Verhältnisse zu verändern, aber den Menschen zu helfen, einen besseren Umgang mit ihren Problemen zu finden. Sie kann dabei unterstützen, dass es Betroffenen besser geht und sie die Kraft haben, etwas an ihrer Situation zu ändern. Dazu ist es wichtig, dass Therapeut:innen eine gute Beziehung zu ihren Klient:innen aufbauen. Essentiell ist hierbei vor allem, dass Klient:innen Vertrauen zu ihnen fassen können und sich trotz unterschiedlicher Lebensrealitäten von ihren Therapeut:innen verstanden fühlen, betont Muckenhuber.
Als wichtigsten Schritt zu diesem Ziel sieht Muckenhuber die Reflexion der eigenen Privilegien von Psychotherapeut:innen und darüber, wie man armuts- und klassismusbetroffenen Menschen in der Therapie angemessen begegnen kann. Damit das gelingt, müssen aber vor allem kassenfinanzierte Psychotherapieplätze ausgebaut und mehr über die Möglichkeiten von Psychotherapie aufgeklärt werden. Erst dann kann Therapie auch für Menschen mit wenig Einkommen eine gut erreichbare Gesundheitsleistung darstellen.
Heute wohnt und studiert Mary in Wien. Sie hat an der Uni Freunde gefunden, die auch aus Arbeiter:innenfamilien stammen und von denen sie sich verstanden fühlt. Der Umzug in die Hauptstadt hat ihr geholfen, besser auf sich zu schauen und ihre Symptome ernst zu nehmen. Ob sie nach ihren negativen Erfahrungen jemals wieder Therapie in Anspruch nehmen wird, weiß sie nicht.
Als zwei Freunde von Larissa sie ermuntert haben, sie nach Wien zu begleiten, hat sich Larissa für ein Studium entschieden. Sie hat es geschafft, sich mit Hilfe eines Gastronomie-Jobs und der Studienbeihilfe die Ausbildung zu finanzieren. Heute arbeitet sie in einer sozialen Einrichtung, die benachteiligten Jugendlichen Unterstützung bietet. Wenn familiäre Themen erstmal so weit bearbeitet sind, dass sie sie nicht weiter blockieren, möchte sie sich ein Leben ohne finanzielle Sorgen aufbauen. Ein gesichertes Einkommen zu haben, steht für Larissa an erster Stelle. Darüber hinaus möchte sie sich im Kampf gegen Armut engagieren und dazu beitragen, dass andere Kinder und Jugendliche unter besseren Bedingungen aufwachsen als sie – und so schließlich mit einer besseren psychischen Gesundheit ihr Leben bestreiten.
Über die Illustratorin Ruth Gafko
Ruth Gafko ist tagsüber als Deutschdozentin in Mexiko-Stadt tätig und nachts den Ausgleich in allen möglichen kreativen Betätigungen suchend. Sie mag tacos und Rad fahren.
Weitere Quellen zum Thema
- Armutskonferenz
- Berufsverband Österreichischer PsychologInnen. 2020. Psychische Gesundheit in Österreich. Eine Studie des Berufsverbandes Österreichischer PsychologInnen durchgeführt von Karmasin Research & Identity.
- Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz. 2019. Gender-Gesundheitsbericht Schwerpunkt Psychische Gesundheit am Beispiel Depression und Suizid. Ergebnisbericht.
- Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz. Richtlinien zur Ausübung des Psychotherapeut:innen-Berufs sowie für Aus- und Weiterbildungen
- Frasl. 2022. Patriarchale Belastungsstörung. Geschlecht, Klasse und Psyche. Haymon Verlag.
- Kuglemass. 2016. Sorry, I’m Not Accepting New Patients. An Audit Study of Access to Mental Health Care. Journal of Health and Social Behaviour.
- Lampert et al. 2016. Soziale Ungleichheit und Gesundheit. Stand und Perspektiven der sozialepidemiologischen Forschung in Deutschland. Bundesgesundheitsblatt.
- Lampert, Kroll, Hapke & Jacobi. 2014. Sozioökonomischer Status und psychische Gesundheit. Public Health Forum.
- Moment Magazin. Warum Psychotherapie offener werden muss.
- Österreichischer Bundesverband für Psychotherapie. Mehr Psychotherapie jetzt.
- Psychotherapie: Informationen zu Zuschüssen der unterschiedlichen Krankenkassen.
- psy online. Informationen zur Psychotherapie-Ausbildung.
- Riffer et al. 2022. Psychotherapeutische Versorgung in Österreich: Kassenfinanzierte Psychotherapie für Menschen mit chronisch psychischen Erkrankungen im Jahresvergleich 2017 bis 2020. Psychotherapie Forum 26.
- Ruck & Rothmüller. 2023. Psychologisierung von Ungleichheiten. In: Handbuch Soziale Ungleichheit. Beltz.
- Seeck. 2022. Zugang verwehrt. Keine Chance in der Klassengesellschaft: wie Klassismus soziale Ungleichheit fördert.
- Statistik Austria. 2021. Lebenserwartung bei der Geburt 2020 nach regionalen Gliederungen.
Diese Recherche ist im Rahmen der ZIMT-Werkstatt entstanden.